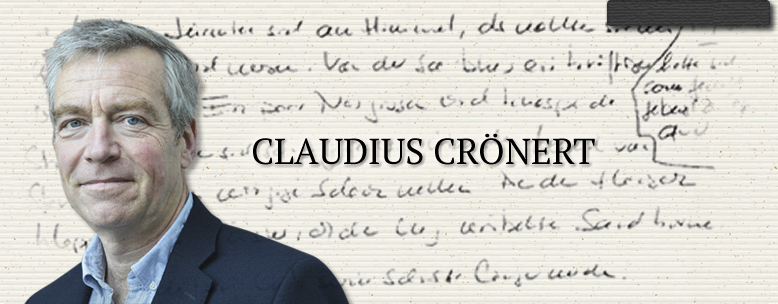Prolog
Die Stadt schläft.
Kein Wunder, es ist ein früher Sonntagmorgen und noch einige Stunden hin, bis die Kirchenglocken läuten und der Gottesdienst beginnt. Da macht sich ́s mancher bequem und ruht aus von sechs Tagen Plackerei. Der eine oder andere dreht sich noch einmal im Bett herum und tastet nach seiner Frau neben ihm oder fasst sich an den pochenden Schädel, denn am Ende der Woche neigen die Leute dazu, zu viel unverdünnten Wein zu trinken, und am Morgen zahlen sie den Preis dafür.
Ich bin allein auf dem Kirchhof. Nur die Vögel zwitschern bereits. In den halbhohen Sträuchern, die diesen geweihten Ort begrenzen, sitzen sie und singen ihre Lieder. Ob Sonntag oder Montag, das ist ihnen ganz egal, und der himmlische Vater nährt sie doch, wie der Evangelist sagt.
Ich bin allein, und ich habe Zeit.
Auch in diese Pfarrkirche werden bald die Gläubigen strömen. Dann wundern sie sich vielleicht, was ein einzelner Mann hier an den Gräbern macht, und winken mich zu sich. Ich werde sie übersehen. Es ist mir nicht leichtgefallen, doch ich habe gelernt, stur zu sein. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, bleibe ich dabei. Das ist heute der Fall. Ich will Euch meine Geschichte erzählen, Meister. Sie hat viel mit Euch zu tun.
Der Sommer ist vorbei. An den ersten Bäumen färbt sich das Laub, und die Sonne hat nicht mehr die Kraft, einen ins Schwitzen zu bringen. Passender wäre es, ich stünde im Frühling hier; das hätte etwas Rundes, einen Anfang und ein Ende, die sich harmonisch fügen. Doch es geht nicht immer alles auf, auch das habe ich im Laufe der Jahre begriffen. Das wahre Ziel ist, das Beste aus dem zu machen, was man hat.
So oder so ähnlich lautet, glaube ich, der Leitsatz meines Lebens.
I
1237
An einem Sonntag im April kam ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Paris.
Zwei Tage waren wir gewandert, Vater oft einige Schritte vor mir, und ich sah immerzu seinen Rücken und den Stab, den er bei jedem zweiten Schritt in die Erde stieß. Seine Schritte waren weit, der Gang stapfend, den Kopf hielt er meistens gesenkt.
Schon aus der Ferne konnte ich die Stadt am Horizont ausmachen. Zunächst war sie vom Waldrand und den Feldern aus gesehen nur ein schwarzer Punkt in der Landschaft. Beim Näherkommen dehnte er sich langsam aus, wurde ein Fleck, dann ein Fels, nahm scharfe Konturen an und war am Ende größer als alles, was ich bis dahin gesehen hatte.
Alles hatte gewaltige Ausmaße, selbst die Schlange, die sich vor dem südlichen Tor gebildet hatte. Eine endlose Reihe von Ochsenkarren stand da, einer hinter dem anderen. Die Bauern aus den umliegenden Dörfern, die selbst am Tag des Herrn die Stadt versorgten, warteten auf Einlass. Die meisten saßen zusammengesunken auf ihren Kutschböcken, dämmerten in einer Art Halbschlaf, während ihre Tiere die Köpfe zum Wegrand gedreht hatten und die letzten Grasbüschel aus dem sandigen Boden zu ziehen versuchten.
Vater wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf mich. Sicherlich fürchtete er, mich im Gedränge zu verlieren. »Pierre, trödel nicht«, rief er. »Komm endlich.«
Für Fußgänger gab es ein eigenes, kleineres Tor. Die Wachsoldaten, mit Piken bewaffnet, winkten uns hindurch, genauso wie all die Händler, Musikanten, Bettelmönche und sonstigen Reisenden, die mit uns Einlass begehrten. Ich war erschöpft, außerdem hatte ich Durst. Mein Wasserschlauch war leer.
Unterwegs hatte ich mir oft vorgestellt, dass meinen Vater sein Gewissen quälte, weil er mich mit dreizehn Jahren weggab. Wissen konnte ich das nicht, er redete zwar mit mir, wenn wir zwischendurch nebeneinander gingen, doch kaum über das, was ihn beschäftigte. Stattdessen benannte er die Bäume des Waldes und die Vögel, die wir hörten, und zeigte mir, welche Beeren essbar waren und von welchen ich lieber die Finger ließ.
Sein Lieblingsthema aber war das Bauen, und er sprach viel über die Kathedralen, die überall im Land entstanden, gedacht zur höchsten Ehre Gottes, große Kirchen, die alles überragten, was je von Menschenhand geschaffen worden war. Jede französische Stadt, die etwas auf sich hielt, wollte eine haben, auch Chartres, von wo wir kamen. Ich kannte die Baustelle der dortigen Kathedrale und hatte deshalb eine Vorstellung von dem, was er mir vermittelte, von der Höhe der Mauern, den spitzen Bögen und den schlanken Türmen.
Paris kam mir vor wie ein gigantischer Ameisenhaufen. Menschen und Fuhrwerke, die alle ein Ziel hatten, unzählige Häuser, immer neue Märkte für Getreide, Obst und Gemüse, für lebende Tiere und für geschlachtetes Vieh, für gesponnene Wolle, Kleidung und Schuhe, ein wenig abseits auch für schützende Amulette, Hellseherei und andere heidnische Gebräuche. Dazu ununterbrochener Lärm und ein beißender Gestank. Jemandem wie mir, der nicht viel mehr als unser überschaubares Chartres kannte, kam all das unwirklich vor.
Ein nie abreißender Strom von Menschen bewegte sich durch die lehmigen Straßen und die engen Gassen, Männer genauso wie Frauen, und alle trugen irgendetwas bei sich. Auch eine Menge Kinder waren unterwegs. Ich bekam vor Staunen den Mund kaum zu. Am liebsten wäre ich stehen geblieben und hätte dem Treiben zugeschaut, doch Vater drängte vorwärts, und inzwischen fürchtete auch ich, wir könnten uns verlieren. Er kannte den Weg, während ich keine Ahnung hatte, wo wir waren oder wohin wir mussten.
Die Häuser und Hütten standen meist dicht an dicht, eine Wand lehnte sich an die nächste. Die meisten von ihnen waren mit Schilf gedeckt, und ihre Fensterläden waren geschlossen, sodass sie abweisend wirkten. In der Straßenmitte lief der Unrat durch eine steinerne Rinne. Ich fragte mich, ob die Anwohner in ihren Höfen keine Gruben hatten. Kannte man so etwas in Paris nicht?
Die Gerüche verschlugen mir den Atem, während der Lärm der Stadt in mich eindrang wie ein Messer in einen weichen Käse. Leute stritten oder lachten, beides gleich laut. Vor mir gingen zwei Frauen Hand in Hand und sangen ein lustiges Lied, wobei sie ihre Arme im Takt schwenkten. Ein Bauer mit rotem Kopf brüllte seinen unbeweglichen Ochsen an und wedelte mit der Knute vor seinen Augen. Hinter ihm drängten drei Reiter in edler Kleidung, adelige Herren, Pelze an ihren Umhängen, gewohnt, dass man ihnen Platz machte. Der eine von ihnen zog sein Schwert und befahl dem Bauern, den Weg frei zu geben. Dessen Ochse aber rührte sich nicht. Der Bauer brüllte noch lauter und begann, auf das Tier einzuschlagen. Dabei wurde sein Kopf dunkelrot und sah aus, als würde er gleich platzen.
Ich konnte nicht bleiben und den Ausgang der Auseinandersetzung abwarten, mein Vater war schon wieder ein ganzes Stück vor mir. Er schien keinen Blick für die Stadt zu haben, sondern stieß seinen Wanderstab wieder in den Lehm und stapfte immer weiter. Ich rannte hinter ihm her und holte ihn kurz vor dem Flussufer ein, wo Angler bis zu den Knien im Wasser standen und ihre Ruten ausgeworfen hatten.
Die Seine war genauso befahren wie die großen Straßen. Obwohl es kaum Wind gab, flatterten bunte Segel auf dem Wasser, dazwischen fuhren Ruderkähne, große wie kleine, alle beladen, manche so sehr, dass sie zu tief lagen und Wasser über die Bordwand hineinschwappte.
Ich fragte mich, ob in einer Stadt wie Paris der Sonntag überhaupt eine Bedeutung hatte. Glaubten die Bürger hier an denselben Gott wie wir in Chartres, an den, der, nachdem er die Erde erschaffen hatte, nicht nur selbst am siebten Tag ruhte, sondern von uns Menschen verlangte, es ebenso zu halten? Meinem Vater konnte ich diese Frage nicht stellen, er war schon wieder voraus.
Er bog ab, weg vom Wasser. Offenbar wohnten die Leute, zu denen er wollte, auf dieser Uferseite. Doch dann blieb er plötzlich stehen und wirkte unentschlossen. Sein Kopf bewegte sich erst in die eine, dann in die andere Richtung. Er drehte um. Nahm doch die Brücke.
Ich eilte ihm hinterher.
Mir kam es vor, als ob die Gassen auf der anderen Seite des Flusses noch einmal enger und voller waren. Überall Menschen und Tiere, ein einziges Gewühl. Die Mitte von Paris, das Herz des Ameisenhaufens.
Ich griff nach dem Saum von Vaters Kittel und hielt mich daran fest. Tapste ihm hinterher und schaute erst wieder auf, als er an einem Holzzaun haltmachte.
Als ich zwischen den Latten hindurchlinste, erblickte ich eine Baustelle, so groß, dass sie weder Anfang noch Ende zu haben schien. Ein Himmelsschiff, dachte ich. Entweder eins, das gerade gebaut wurde. Oder aber eins, das hier gelandet war, und Gott selbst hatte den Handwerkern befohlen, es wieder flottzumachen.
Der Platz war am Sonntag menschenleer, doch es gab deutliche Spuren, die mir zeigten, dass viele von ihnen seinem Aufruf gefolgt waren. Eine Menge Leitern und Bottiche waren ordentlich aufgereiht, leere Wagen und Karren standen dort nebeneinander. Die Wände des Gebäudes in ihrer unterschiedlichen Höhe bildeten Absätze mit scharfen Kan- ten. Sie waren aus dem gleichen grauen Stein gemauert, wie er in Paris für die Häuser verwendet wurde. Das ganze Gebilde, ohne Fenster und Dach, sah aus wie das Skelett eines Riesen. An vielen Mauern waren Gerüste befestigt, und es gab Dutzende von Seilzügen.
Ich versuchte, die Bauhütten zu zählen, scheiterte aber zwei Mal. So oder so war es mehr von allem, als ich mir hatte vorstellen können. Gegen diese Baustelle kam mir die in Chartres geradezu übersichtlich vor.
Mein Vater stand und schaute.
»Wird das auch eine Kathedrale? Oder …?« Aus Sorge vor Zurückweisung wollte ich nicht »Himmelsschiff« sagen, aber ein anderes Wort fiel mir nicht ein.
»Sicher«, erwiderte er, »und da wir in Paris sind, soll sie mächtiger werden als alle anderen im Land.« Er neigte den Kopf, ein feines Lächeln umspielte seinen Mund. »Aber in Chartres sind wir um einiges weiter.« Er klang zufrieden. Das war verständlich, schließlich war er dort der Baumeister.
»Das wird noch dauern«, sagte er kopfschüttelnd. Er legte seinen Arm um mich. »Komm, jetzt suchen wir dein neues Zuhause.«
Wir nahmen wieder die Holzbrücke und kehrten zum südlichen Flussufer zurück, wo er nach rechts abbog. Ich fand es verblüffend, wie zielsicher er uns durch die Gassen führte. Für mich sahen sie alle gleich aus.
Er blieb vor einem Haus stehen, das ein wenig zurückgesetzt lag. Auf dem Vorplatz stand rechter Hand ein Schuppen mit einer Bank davor, die aus groben Brettern gezimmert war. Auf der linken Seite gab es einen gemauerten Brunnen. An einer Stange darüber baumelte ein Eimer. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass diese Leute auch eine Grube hatten. Wie bei uns war sie mit Brettern abgedeckt, die man hoch- hob, wenn man seinen Nachttopf darin ausleerte.
Das Haus selbst hatte ein Erdgeschoss aus Stein und einen etwas schiefen ersten Stock aus Holz. Oben standen die Fensterläden offen.
Vater zögerte zum ersten Mal. Schaute nach links und nach rechts. Wieder zu dem Haus. An der Tür gab es keinerlei Hinweis auf die Bewohner, keinen Namen, kein Symbol einer Bruderschaft oder überhaupt eines Handwerks. Er legte den Kopf schief. Ich stellte mich neben ihn. Er schritt beherzt auf die Haustür zu. Ich blieb hinter seinem Rücken, wo ich nicht gesehen werden konnte, wie ich hoffte. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in mir aus. Ich fürchtete mich und fühlte mich schon jetzt, obwohl mein Vater noch bei mir war, allein und verloren. Ich sehnte mich nach zu Hause und nach meinen Geschwistern.
Vater klopfte vorsichtig.
Niemand öffnete.
Er klopfte erneut, diesmal etwas kräftiger. Ich wäre am liebsten davongelaufen, doch im nächsten Moment erschien schon eine Frau an der Tür. Sie trug ein hellgraues Wollkleid, das bis zu den Knöcheln reichte, und eine weiße Haube. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen, da sie im Halbdunkel der Türschwelle stand.
»Entschuldigen Sie, Madame«, brachte mein Vater stockend hervor. Seine Stimme klang rau, wie eine Säge auf Holz. »Ist dies das Haus von Meister Jean?«
»Dann seid Ihr Meister Hugo aus Chartres?«
»Der bin ich.«
Die Frau drehte ihren Kopf und rief ins Hausinnere: »Jean, dein Besuch ist da!« Meinem Vater entbot sie einen Willkommensgruß. »Und du«, sagte sie zu mir, »bist sicher Pierre.«
»Ja, Madame«, erwiderte ich mit meinem trockenen Mund und ohne sie anzuschauen.
Sie lächelte mir zu. »Komm rein, Pierre.«