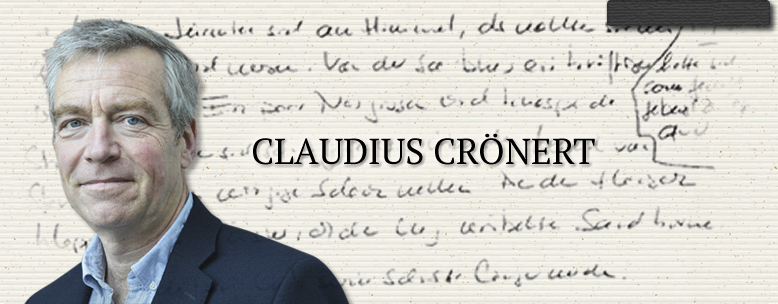Prolog
Auf diesen Brief hatte Fee fast zwei Wochen gewartet und am Ende kaum noch mit ihm gerechnet, doch nun war er da, ein hellblauer Umschlag aus rauem Papier, die Adresse mit der Maschine geschrieben. Man konnte sie kaum lesen, so blass war das Farbband: »Frl. Felicitas v. Reznicek, Wilmersdorfer Straße 94, Berlin-Charlottenburg«. Absender war die Entnazifizierungskommission für Kunstschaffende, ebenfalls in Charlottenburg, Schlüterstraße 45. Eine der Typen, das L, war am Hebel verrutscht, sodass der Buch- stabe höher anschlug als die anderen, was den Eindruck des Selbstgestrickten im Schriftbild verstärkte. Vor fünf Jahren, mitten im Krieg, hätten Beamte einer deutschen Behörde schnurstracks den Mechaniker kommen lassen, damit er den kleinen Fehler behebe. Aber es war nichts mehr wie vor fünf Jahren.
Mit dem Brief in der Hand stellte sie sich an ihr Wohnzimmerfenster, drehte den Messinggriff in die Waagerechte und zog es auf. Die Sonne schien herein, es war leidlich warm, ein paar Wolken wanderten gemächlich über den Himmel.
Auf beiden Seiten des Hofes gab es keine Häuser mehr, kaum noch Mauern, links war überhaupt nichts stehengeblieben, rechts ein Steinskelett mit einem Berg aus Schutt zu seinen Füßen, auf dem drei Jungen in kurzen Hosen herumkletterten und dabei Staub aufwirbelten. Es hieß, die Eigentümer wollten ihr Haus neu aufbauen, wenn es wieder Banken und Kredite gab und man Handwerker fand. Kein Mensch wusste, wann das sein würde.
Der Rest der Nachbarschaft bis hinunter zum Kurfürstendamm war kahl, eine Wüstenlandschaft, die Steine waren abtransportiert, den Platz auf den Grundstücken hatten sich Löwenzahn und Brennnesseln erobert. Ihr Haus war als einziges stehengeblieben. Wie durch ein Wunder, pflegten die Leute zu sagen, aber das stimmte natürlich nicht, es war kein Wunder gewesen, sondern ein guter Einfall und dessen beharrliche Umsetzung. Fees Einfall. Auch ihre Sturheit. Gegen den Willen der Nachbarn, die ihr einen Vogel gezeigt hatten, hatte sie in der Zeit der Fliegerangriffe Holzfässer aufs Dach schleppen lassen und dafür gesorgt, dass sie stets voll waren. Als die Bomben dann einschlugen und es brannte, waren sie die Einzigen gewesen, die löschen konnten, wenn auch nur mit einem langen Gartenschlauch. Fee hatte damals erkannt, dass das größte Problem bei Treffern der Wassermangel war. Die Feuerwehr vermochte nichts auszurichten, weil alles Wasser schnell verbraucht war, und die Bewohner standen wie erstarrt vor ihren Häusern und mussten zusehen, wie sie nie- derbrannten. Also hatte sie vorgesorgt. Zum Dank hatte eine Nachbarin sie später bei den Russen angeschwärzt. Sie sei mit verschiedenen Parteigrößen wie etwa dem SS-Gruppenführer Artur Nebe gut bekannt gewesen. Eine Nazifreundin.
Sie legte den Umschlag auf das Tischchen am Eingang, wo ihr Telefon stand, und setzte Teewasser auf. Tee war eine Kostbarkeit in diesen Tagen, nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, deshalb geizte sie mit den Blättern, die sie ins Sieb füllte. Lieber ließ sie ihn etwas länger ziehen, damit er nicht nur wie dunkles Wasser aussah. Zucker gab es nicht dazu, Milch auch nicht.
Vor einigen Monaten hatte sie, wenn auch mit Widerwillen, den amerikanischen Fragebogen ausgefüllt, hatte alle
131 Fragen mit einiger Sorgfalt beantwortet. Ihre Parteimitgliedschaft – Frage 40. In der folgenden Liste ist anzuführen, ob Sie Mitglied einer der angeführten Organisationen waren und welche Ämter Sie dabei bekleideten – hatte sie angegeben, denn sie war davon ausgegangen, dass die entsprechen- den Karteikarten in irgendwelche Keller oder Höhlen aus- gelagert worden waren und die Bombenangriffe überstanden hatten. Inzwischen hatte sie gehört, dass mancher Kollege nicht so ehrlich gewesen war, seine Zugehörigkeit zu Partei und Organisationen verschwiegen hatte und inzwischen wieder arbeitete. Möglicherweise war sie zu naiv gewesen. Wie sollten die alliierten Beamten Millionen von Fragebögen überprüfen, bei denen jede einzelne Antwort mit deutschen Akten abgeglichen werden musste? Dafür hätte man ein ganzes Heer von Mitarbeitern gebraucht, und die Engländer zumindest, die inzwischen gemeinsam mit den Amerikanern die Bizone verwalteten, hatten andere Sorgen, zu Hause und in ihrem Empire.
Im Fragenbogen war kein Platz gewesen, um auf die speziellen Umstände ihrer Mitgliedschaft einzugehen. Wegen ihrer Auslandsreisen – Frage 125. Zählen Sie alle Reisen oder Wohnsitze außerhalb Deutschlands auf (Feldzüge inbegriffen). Frage 126. Haben Sie die Reisen auf eigene Kosten unternommen? Frage 127. Falls nein, auf wessen Kosten? – hatte sie bereits mehrere Extraseiten beigelegt, das war ihr wichtig gewesen, denn wer während des Krieges hatte reisen dürfen, der war verdächtig. Kein alliierter Beamter, hatte sie unter- stellt, würde lesen wollen, auf welch seltsame Weise sie Parteigenossin geworden war. Außerdem hätte die Erklärung wie eine billige Entschuldigung geklungen. Und natürlich war sie Mitglied der Reichsschrifttumskammer gewesen. Jeder, der veröffentlichte, war das. Man konnte nur hoffen, dass die Alliierten das wussten.
Bei ihr hatte die Behörde von Anfang an stur nach den Regeln entschieden: Parteizugehörigkeit gleich Veröffentlichungsverbot. Trotzdem hatte sie eine Arbeit, sie schrieb für die Agentur Reuters, was sie einem alten Bekannten aus San Francisco zu verdanken hatte, Webster K. Nolan. Er habe viele Freunde und werde sehen, was er für sie tun könne, hatte er ihr geschrieben, als sie ihn vor etwa einem Jahr um Hilfe gebeten hatte; Informationen aus Berlin seien doch begehrt. Ein paar Tage später hatte sich Reuters telefonisch gemeldet, die im amerikanischen Sektor ein Büro betrieben. Voller Hoffnung war Fee dorthin gefahren. Inzwischen war sie ernüchtert. Sie hatte festgestellt, dass die amerikanischen Reporter den größten Teil der Arbeit selbst erledigten. Für sie, die deutsche Kollegin, fielen nur ein paar Krümel ab, bedeutungslose Termine, Randnotizen, für die sich die Amis zu fein waren. Das Honorar reichte hinten und vorne nicht. Obwohl sie kaum etwas ausgab, war das Geld immerzu knapp, des- halb musste sie endlich wieder Regelmäßigkeit in ihre Tätigkeit bringen, und das ging nur, wenn sie für deutsche Zeitungen schrieb. Zudem hatte sie ein Großprojekt im Kopf, eine mehrteilige Reportage über den Widerstand, die viel- leicht dazu beitragen konnte, dass das allgemeine Bild von Deutschland ein wenig zurechtgerückt würde. Sie war erst Anfang 40. Kein Alter, um aufzugeben.
Im Gerichtsverfahren würde sie deutschen Bürgern Rechenschaft über ihr Leben in diesen zwölf Jahren ablegen müssen. Die Richter waren anerkannte Opfer des Faschismus, entweder ehemalige Inhaftierte oder Emigranten. Sie hatte Respekt vor ihrem Schicksal, aber die Frage war, was diese Leute von den Zugeständnissen wussten, die man für ein Überleben diesseits von Flucht oder Gefangenschaft hatte machen müssen. Kannten sie das Gefühl, das sich einstellte, wenn man immer weitermachte, während andere abgeholt wurden und man wusste, dass sie nie wiederkommen würden?
Der Tee zog noch, sie deckte eine Tasse mit der Untertasse ab. Ihr Porzellan hatte seltsamerweise alle Fliegerangriffe überstanden. Die Wohnungstür war eines Nachts durch den Druck einer Bombenexplosion herausgeflogen, die Fenster- scheiben waren zu Bruch gegangen, aber das Porzellan im Schrank hatte nur ein wenig gewackelt. Sie begriff nicht, wie das möglich war. Hätte es gerne verstanden.
Die Vorstellung belastete sie, dass sie sich ein zweites Mal vor fremden Leuten für ihr Leben rechtfertigen sollte. Als sie über dem amerikanischen Fragenbogen gesessen hatte, war ihr der Gedanke im Kopf umhergegangen, dass auch die Sieger die eine oder andere Frage beantworten müssten. Sie hätte einige davon gerne dazugeschrieben, zum Beispiel: »Haben Sie je verfolgten Juden die Aufnahme in Ihr Land verweigert?« Oder: »Haben Sie oder Sportler Ihres Landes bei den Spielen 1936 den rechten Arm zum Hitlergruß gegen die Haupttribüne gereckt?« Oder als drittes: »Was hat Ihre Regierung unternommen, als Hitler im gleichen Jahr, 1936, Truppen der Wehrmacht widerrechtlich ins Rheinland marschieren ließ und Sie von deutschen Spionen wussten, dass er sich bei der geringsten militärischen Gegenwehr sofort zurückgezogen hätte? (Übrigens haben wir unser Leben riskiert, um Sie mit dieser Information zu versorgen.) Hätten Sie nicht den Anfängen wehren müssen, als wir es nicht mehr konnten?«
Sie hatte diese Fragen nicht gestellt und würde sie nie stellen. Die Stimmung war eine andere, wer auch nur einen Teil der Verantwortung anderswo suchte, galt als uneinsichtig, als ewiger Nazi. In diese Nähe wollte sie nicht gerückt werden.
Also würde sie darüber Rechenschaft ablegen, ob sie als Autorin zu viele Zugeständnisse gemacht hatte. Das war das, was anstand. Ein Anflug von Bitterkeit stieg in ihr auf. Sie kämpfte das Gefühl nieder. Es sollte nicht ihr Leben bestimmen.
Der Brief auf dem Flurtischchen hatte lange genug gewartet. Sie holte ihn in die Küche und schenkte sich Tee ein. Er enthielt die Aufforderung, 1.206 Reichsmark an Gebühr zu entrichten. Wenn sie gezahlt hatte, hieß es in dem Schreiben, würde die Verhandlung vor der Schwurkammer am 28. Mai 1947 stattfinden. Sie hatte dieses Geld nicht. Natürlich konnte sie versuchen, sich welches zu leihen, und stellte sich vor, einen Bekannten um Hilfe zu fragen. Spielte es noch eine Rolle, so oft, wie man sich schon gedemütigt hatte für ein Stückchen Butter oder eine Scheibe Schinken, weil man nicht schon wieder Steckrüben ohne jedes Fett essen wollte? Doch, es spielte eine Rolle, und wenn sie diesen Weg nicht erneut gehen wollte, musste sie sich von dem letzten Wert trennen, den sie noch besaß: der Schmetterlingssammlung ihres Vaters.
*
Ihr Vater war im Sommer 45 gestorben, kurz nach Kriegsende und wenige Monate, nachdem er in das zerbombte Berlin zurückgekehrt war. Selbst in seinem dämmrigen Zustand hatte er damals erkannt, wie sehr die Stadt in Schutt und Asche lag, und die Hände vors Gesicht geschlagen. Sie hatten ihn in Stahnsdorf beerdigt, wo die Russen waren. Es war eine groteske Beisetzung gewesen, der letzte Akt im Leben eines Künstlers, eines Musikers. Den Leichenwagen hatten sie mit Benzin betrieben, das ihr Curt Riess, ein früherer Kollege, geschenkt hatte, der emigriert und als amerikanischer Leutnant nach Berlin zurückgekehrt war.
An der Zonengrenze hatte der zuständige sowjetische Offizier ihnen mitgeteilt, er habe neue Soldaten einer anderen Kompanie bekommen, für die er nicht garantieren könne, deshalb sei es besser, wenn die Frauen allesamt auf amerikanischem Gebiet blieben. Den Sargträgern riet er, alles auszuziehen, was man ihnen abnehmen könne. So wurde Emil Nikolaus von Reznicek von Männern in Unterhosen zu Grabe getragen. An der Seite gafften feixende Rotarmisten, während Fee nur von Weitem zuschauen konnte. Ihr Halbbruder Burghard war gar nicht erst erschienen. Er lebte mittlerweile in Köln, die Reise, so hatte er ihr am Telefon erklärt, sei nicht möglich, er bekomme keine Genehmigung dafür.
Die elterliche Wohnung musste sie alleine auflösen, acht Zimmer, vollgestellt mit Erinnerungen und altem Mobiliar. Bücher brachten auf dem Schwarzmarkt nichts, Orientteppiche kaum mehr. Für das Klavier hatte sie Lebensmittel für ein paar Tage erhalten. Russische Soldaten hatten zwei Klei- der und den Wintermantel ihrer Mutter gegen Butter, Speck, zwei Kilo Buchweizen und eine Flasche Wodka eingetauscht. Den größten Wert hatten Briefe gehabt, die Komponistenkollegen wie Hindemith, Alban Berg oder Richard Strauss an ihren Vater geschrieben hatten. Eine Zeit lang hatte sie davon gelebt, immer mal wieder einige dieser Briefe zu versilbern. Jetzt gab es nur noch die Schmetterlinge, beinahe 10.000 Stück in Schaukästen und Pappschachteln.
Sie sah ihren Vater vor sich, wie er sich in seine Sammlung vertieft hatte, während die Welt um ihn in Trümmer fiel. Stundenlang hatte er die Präparate mit der Lupe betrachtet. Jedes der Tiere hatte er selber gefangen, in jüngeren Jahren war er auf der Jagd nach seltenen Exemplaren mit dem Netz durch die Alpen gelaufen, über Wiesen und Felsen und Schneefelder. Von ihm hatte Fee die Leidenschaft für die Berge geerbt. Ihr
Vater kannte jede Schmetterlingsart, eine, die bis dato unbekannt war, hatte sogar seinen Namen erhalten. Seine Sammlung besaß einen Ruf unter Fachleuten und hatte Wissenschaftler interessiert. Doch nun war es vorbei. Ihr Vater war tot, und sie wollte weiterleben.
Es gab ein praktisches Problem: Der nächste Schwarzmarkt war zwar in der Nähe, am Bahnhof Charlottenburg, dennoch konnte sie die Schaukästen nicht dorthin transportieren, dazu waren es viel zu viele und sie waren zu sperrig und zu schwer. Ein Auto hatte sie nicht. Schließlich nahm sie nur die Registraturhefte mit, abgegriffene Büchlein mit schwarzem Ledereinband, in denen ihr Vater mit seiner feinen Frakturschrift jedes Stück seiner Sammlung festgehalten hatte. Nach einigen Stunden des Wartens und Anbietens fand sie einen Interessenten, einen etwas schmierigen Herrn mit gezwirbeltem Bart und einem Päckchen Camel in der Brusttasche, der am Ende nicht einmal selber zum Abholen kam, sondern zwei junge Burschen schickte, die die Schaukästen heraustrugen und auf einem Pferdewagen festzurrten. 1.800 Reichsmark gaben sie ihr dafür, wie verabredet.
Am nächsten Tag zahlte sie die verlangte Gebühr ein. Ihre Zeugen hatte sie angeschrieben und der Kammer benannt, Doktor Pechel war zweifelsohne der wichtigste von ihnen. Pechel war ein Freund gewesen, er wusste viel über sie aus dieser Zeit und würde für sie sprechen. Seine Persönlichkeit und seine Aussage hatten wahrscheinlich so großes Gewicht bei den Richtern, dass sie das Urteil günstig beeinflussen würden. Inzwischen wurde ihr aber immer bewusster, dass es nicht um das Publikationsverbot ging, jedenfalls nicht nur. Es stand eine andere, viel gewichtigere Frage im Raum, und die hieß, ob sie zu sehr beteiligt gewesen war. Sie hatte lange auf die Verhandlung gewartet, jetzt grauste ihr davor. Fast noch schlimmer drohten die Wochen bis zu ihrem Beginn zu werden. Die alte Zeit war nicht vorbei, im Gegenteil, sie begann gerade wieder. Alles von vorn.
1. Kapitel
1.
Der 30. Januar 1933 war ein Montag, und Fee verbrachte ihn im Hotel Adlon. Genauso wie das gesamte Wochenende zuvor spielte sie Bridge. Ihre Mutter hatte ihr das Spiel bereits als Kind beigebracht, Fee hatte es im Laufe der Jahre immer weiter verfeinert, hatte sogar ein englisches Lehrbuch über- setzt, 1.000 Seiten, mit vielen Beispielen. Sie betreute die Bridgeecke in der Vossischen Zeitung, schrieb über Bietsysteme und Spieltechniken und gewann hin und wieder renommierte Spieler als Autoren. In der Redaktion war ihr, als sie von ähnlichen Vorhaben in Österreich und Amerika gelesen hatte, auch die Idee gekommen, einen internationalen Verband zu gründen. Sie hatte Adressen von Klubs aus England, Frankreich und Holland gefunden und sie angeschrieben, und ein Jahr später waren sie alle in Amsterdam zu einem Gründungswochenende zusammengekommen. Selbstverständlich gehörte ein jährliches Turnier dazu, es war geradezu der Clou an der Sache, an wechselnden Orten, in diesem Jahr in Berlin.
Sie ließ sich gegen die plüschige Lehne ihres Sessels sinken und betrachtete anhand einer Liste, was sie da organisiert hatte. Je vier Spieler aus den verschiedenen Ländern, dazu vier aus ihrem Berliner Klub. Eine Menge Planung war vor- ausgegangen, unzählige Briefe, die sie alle selbst hatte tippen müssen, denn ihre Sekretärin konnte kein Englisch und erst recht kein Französisch. Fee aber war in ihrem Element gewesen. Sie hatte jedem Mitspieler den gleichen Brief geschrieben, selbstverständlich mit eigener Anrede. Formuliert in einer kameradschaftlichen Sprache, mit einem Wir-Gefühl.
Den Termin hatte sie an das Amsterdamer Turnier angelehnt und genau geplant, nicht zu nah an Weihnachten und Neujahr, aber weit genug von Ostern entfernt. Seit einem halben Jahr, seit dem Juli 1932, stand er fest und hatte damals so fern in der Zukunft gelegen, dass alle zugesagt hatten. Trotzdem war Fee bis zum Schluss einen Rest von Zweifel nicht losgeworden und hatte in stillen Momenten befürchtet, dass alles ausfallen würde. Gegen ihre Unruhe hatte sie sich ein Kleid nähen lassen, der Jahreszeit entsprechend aus
Wolle, hatte sich sorgfältig angezogen und geschminkt und war reichlich früh ins Hotel gefahren. Dort trank sie in der Halle mehrere Kännchen Kaffee, bis schließlich eine Mannschaft nach der anderen eintrudelte, allesamt in Mäntel und Schals gepackt und trotzdem frierend. Die Westeuropäer hatte keine Vorstellung davon, was ein Berliner Winter war.
Ein eisiger Ostwind pfiff durch die Stadt, die Temperaturen lagen zwischen minus zehn und minus 15 Grad, auf der Spree trieben dicke weiße Eisschollen, aller Schiffsverkehr war eingestellt, die Seen zugefroren, und an den Straßenlaternen hingen Eiszapfen. Wer konnte, blieb zu Hause, alle anderen stapften steifbeinig durch die Straßen. Das Hotel war gut geheizt, und mit ein wenig Whisky für die Engländer und Holländer und dem einen oder anderen Cognac für die Franzosen wurde den Gästen auch innerlich wieder warm. Sie saßen auf den Sofas, redeten in verschiedenen Sprachen durcheinander und erzählten Geschichten von ihrem ersten Zusammentreffen in den Niederlanden. Die Engländer, deren Team erneut von Colonel Beasley, einem Hauptmann aus dem Weltkrieg, angeführt wurde, hatten eine unnachahmliche Art zu scherzen. Ihr Geheimnis war, dass sie sich nicht nur die anderen Leute oder widrige Umstände vorknöpften, sondern vor sich selbst nicht haltmachten. Unübertroffen dabei war ein Mann namens Domville, ein bärtiger Pfeifenraucher, vom König geadelt, sodass man ihn mit Sir Guy anzusprechen hatte. Bei solchen Temperaturen, erklärte er knochentrocken, würden britische Motoren definitiv nicht funktionieren. »Und deshalb gebe ich Ihnen das Versprechen, dass Großbritannien, falls es jemals wieder das Deutsche Reich angreift, das im Sommer tun wird. Der König ist strikt dagegen, dass seine Soldaten erfrieren.«
Die Mitspieler brüllten vor Lachen. Sir Guy schmunzelte und zog genüsslich an seiner Pfeife.
Als die Gruppe später in den Saal umzog, den Fee gemietet hatte, waren die Tische mit grünen Filzdecken belegt. Turnierleiter war ein Franzose, Monsieur Laplace. Sein Akzent war unüberhörbar, als er auf Englisch den Ablauf bekannt- gab. Das Los wollte es, dass sie für die erste Runde mit den beiden Engländern an einen Tisch kam. Sie hatte besonders Sir Guy beobachtet. Wie beim letzten Turnier war sein Whiskyglas stets voller gewesen als das der anderen, und er hatte es schneller geleert und sich nachschenken lassen, und wie der Mann dasaß, in seinem Tweedsakko und mit gehäkelter Krawatte, die Pfeife in der einen, einen neuen Drink in der anderen Hand, stellte sie ihn sich in einem Herrenhaus irgendwo in Hampshire oder Wessex vor, mit Butler, Gärtner und Köchin, dazu zwei schwarze Jagdhunde und eine Frau mit näselnder Aussprache. Die halbwüchsigen Kinder besuchten wahrscheinlich ein altes Internat, auf das er selbst genauso wie sein Vater bereits gegangen war. Eines Tages würden sie in die elterlichen Fußstapfen treten, so wie er seinen Ahnen nachgefolgt war.
Angesichts des Trinkverhaltens der Engländer ging sie davon aus, dass sie zusammen mit Krämer, ihrem Partner aus dem Berliner Klub, leichtes Spiel mit Sir Guy und dem Colonel haben würde. Selbstverständlich ließ sie sich nichts anmerken, im Gegenteil, während sie reizten, lächelte sie die Gäste freundlich an und machte höfliche Bemerkungen.
Auch als sie ihren Irrtum erkannte, zeigte sie keine Regung. Sir Guy wirkte zwar entspannt, wenn er seine Karten auf- nahm, aber er war hochkonzentriert. Und Colonel Beasley war nicht einen Deut schlechter.
Fee und Krämer verloren die erste Halbzeit. Die beiden Engländer schienen sich blind zu verstehen. Sie reizten ihre Kontrakte jedes Mal voll aus. Gleichwohl erklärte Sir Guy, Beasley und er hätten einfach Glück gehabt.
»Fortune favours fools. Im Laufe eines Turners schleift sich das erfahrungsgemäß ab. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir am Ende nicht Letzte werden.«
Fee hielt diese Aussage für blanke Koketterie. Auch Krämer winkte ab und entgegnete in seinem unbeholfenen Eng- lisch, damit rechne er gewiss nicht. Er war ein Preuße durch und durch, in mittleren Jahren, mit Kurzhaarschnitt und Nickelbrille, ein Ministerialbeamter. Fee kannte ihn seit Langem und mochte ihn, weil sich hinter seiner Beamtensteifheit ein Moment von Großzügigkeit verbarg. Sie gewannen das dritte und vierte Spiel. Die Engländer verloren lächelnd. Sie reichten sich die Hände und sprachen Gratulationen aus.
Fee hatte sich vorgenommen, im Laufe des langen Wochenendes mit jedem der Mitspieler ins Gespräch zu kommen, und suchte sich zu den Mahlzeiten stets einen anderen Tischherrn. Es gab nur zwei Frauen bei dem Turnier, neben ihr eine Holländerin, deswegen musste sie sich um Kontakt nicht bemühen, die Männer kamen zu ihr, die Franzosen mit Handküssen und Komplimenten, die Holländer mit ihrer seltsamen Sprache und die Engländer mit ihrer ewigen Ironie. »Darf ich Sie für ein paar Minuten mit meiner Anwesenheit lang- weilen?«
Am Montagnachmittag beendeten sie die Spiele. Ein französisches Team hatte gewonnen, die Sieger nahmen den Applaus und die vielsprachigen Gratulationen entgegen. Nach und nach verabschiedeten sich die Gäste, holten ihre Koffer aus den Zimmern, knöpften die Wintermäntel zu, zurrten ihre Schals fest und machten sich auf den Weg zum Bahnhof. Vor- her gaben sie sich alle das Versprechen, dass sie sich im kommenden Jahr in London wiedersehen würden. Fee hatte sich diesen Montag freigenommen. Als Gastgeberin blieb sie bis zum Schluss, und als ihr Blick im Hotel auf die Schlagzeile einer Abendzeitung fiel, las sie zwar, dass der Reichspräsident am Vormittag einen neuen Kanzler ernannt hatte, doch jetzt wollte sie davon nichts wissen. Für derlei Dinge war morgen Zeit. Diesen Tag sollten sie nicht verderben.
Die letzten Spieler, die aufbrachen, waren Sir Guy und Colonel Beasley, die sich einen Nachtzug nach Calais gebucht hatten, wo sie am nächsten Morgen die Fähre über den Ärmelkanal nehmen wollten. Zusammen traten sie durch das Portal des Hotels auf die abendliche Straße. Dort aber kamen sie nicht weiter. Vor ihnen stand eine dichtgedrängte Menschenmenge, allesamt mit dem Rücken zu ihnen, die Gesichter der Straße zugewandt.
»What’s going on?«, fragte Sir Guy.
Er hatte seinen Mantelkragen aufgestellt, trug einen karierten Schal und dazu eine Tweedkappe, wie sie Arbeiter im Wedding aufzogen, nur dass sie bei ihm die Ausstrahlung eines britischen Adeligen noch betonte.
Fee schob sich durch die Menge. Die Engländer, beide ihre Koffer in der Hand, folgten ihr, wobei sie andauernd »Excuse me« oder »Sorry« sagten und oft beides zusammen. Obwohl der Abend längst angebrochen war, war es sehr hell, deshalb ahnte sie, was sie sehen würde, und als sie schließlich die erste Reihe erreicht hatte, war sie nicht überrascht. Ein Fackelzug, endlos lang. Braune Uniformen und Marschschritte. Publikum auf beiden Seiten der Straße, Gedränge, soweit man sehen konnte, ausgestreckte Arme. Das passte zu der Schlagzeile der Abendzeitung.
»Was bedeutet das?«, fragte Sir Guy.
Colonel Beasley schaute auf seine Uhr. Sie mussten zum Bahnhof Friedrichstraße und dazu die Linden überqueren. Doch das war schlicht unmöglich. Im Fackelzug gab es keine Lücke. Es war nicht zu erwarten, dass jemand für sie anhalten würde.
Fee stellte sich auf die Zehenspitzen. Der Aufmarsch reichte weiter, als sie blicken konnte, auf der einen Seite bis zum Brandenburger Tor, auf der anderen die Linden hinauf, und überall dichte Reihen von Gaffern. Die Berliner glaubten wahrscheinlich, dass es etwas umsonst gab, und dass sie, wenn sie den rechten Arm nur weit genug reckten, schneller drankämen. Die Tritte der schwarzen Stiefel knallten auf das Pflaster. All die brennenden Pechfackeln, die braunen Uniformen und Fahnen, dazu die schweigenden Marschierer, ihr kindlicher Ernst – die gesamte Veranstaltung hatte etwas Jungenhaftes. Eine Pfadfindertruppe in einem Ferienlager.
Als Sir Guy erneut fragte, was das zu bedeuten habe, erwiderte Fee auf Englisch: »Wenn diese Leute an der Regierung bleiben, dann bedeutet das früher oder später Krieg.«
»Werden sie an der Regierung bleiben?« »Natürlich nicht.«