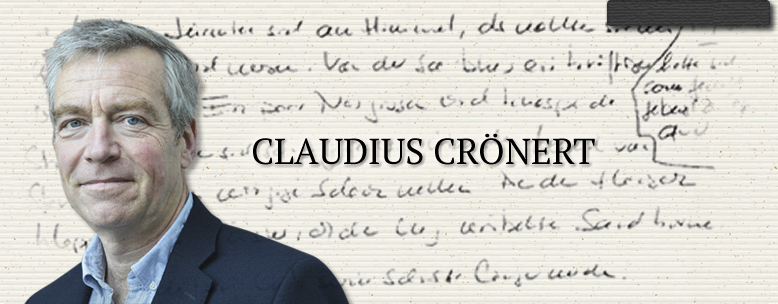Eins
Der Reisewecker auf dem Nachttisch zeigte kurz nach 1 Uhr, als im Wohnzimmer das Telefon klingelte. Hannes Krell versuchte, das Geräusch in seinen Traum einzubauen, doch der schrille Ton passte nicht, deshalb öffnete er die Augen und stand schnell auf. Er wollte vermeiden, dass die ganze Familie wach wurde. Mit einer Hand am Geländer tastete er sich im stockdunklen Haus die Treppe hinab, einerseits eilig, damit der Anrufer nicht auflegte, andererseits vorsichtig, denn die Stufenbretter knarzten laut. Das Telefon hatte einen durchdringenden Ton, der noch lauter war, weil die Wohnzimmertür offen stand.
Krell riss den Hörer von der Gabel. Die Dienststelle, wie vermutet. Ein Toter auf Sankt Pauli. Neben dem Apparat lag ein Block, dazu ein Bleistift. Da kein Licht brannte, konnte Krell nichts sehen. Trotzdem kritzelte er die Adresse, die der Kollege ihm durchgab, auf das raue Papier.
„Ist gut“, sagte er, „rufen Sie bitte Kriminalassistent Schubert an. Ich mache mich auf den Weg.“
Das Badezimmer lag oben, er musste die knarrrende Treppe also wieder hinauf. Unrasiert aus dem Haus zu gehen, war eine lächerliche Vorstellung, und außerdem hingen Hemd und Anzug im Schlafzimmer. Im Bad hatte er das Fenster mit schwarzer Pappe verklebt, so konnte er die Lampe über dem Spiegel anmachen, zumal es nur eine Funzel mit mattem Schein war. Eine stärkere Birne durften sie nicht benutzen, das hatten sie vom Garten aus überprüft, nur dieses schwache Licht war nicht zu sehen. Er schlug die Rasierseife schaumig und pinselte sich ein. Das Messer war nicht richtig scharf, es musste geschliffen werden. Er schob diese Aufgabe bereits seit mehreren Tagen vor sich her, jetzt war er froh über seine Nachlässigkeit, denn wenn man schläfrig war und gleichzeitig in Eile, schnitt man sich leichter.
Er gähnte. Ihm ging ein Gedanke durch den Kopf, den er festhielt: Er konnte selbst entscheiden, wie er sich innerlich zu diesem neuen Fall stellte. Es gab viele Gründe, sich zu ärgern und zu fluchen – nur zwei Stunden Schlaf, und mehr würden es an diesem Tag auch nicht werden, dann das verpasste Frühstück mit der Familie, und möglicherweise würde er auch noch einer Hinterbliebenen die Todesnachricht überbringen müssen. Genauso gut aber konnte er sich frohgemut ans Werk machen. Er war Kriminalbeamter, dies war seine Arbeit, er machte sie gerne, es verschaffte ihm geradezu Freude, mit immer neuen Erkenntnissen und Details Licht ins Dunkel zu bringen. Nicht zu verachten war auch, dass ihm seine Stellung einige entscheidende Vorteile brachte, ein sicheres Einkommen und vor allem, dass er nicht in den Krieg musste. Es gab derzeit wenige Männer in Deutschland, die so gut dastanden wie er.
Dies war die richtige Einstellung. Er nickte seinem Spiegelbild zu, wusch sich den Rasierschaum vom Gesicht, trocknete es ab und schaltete die Lampe aus.
Leise drückte er die Türklinke zum Schlafzimmer herunter.
Wiebke war wach. „Musst du los?“
„Ja.“
„Soll ich dir eine Tasse Kaffee kochen?“
Sie hatten sowieso nur Ersatzkaffee im Haus, ein Zichoriengebräu, das einen nicht wach machte. „Nicht nötig. Schlaf weiter.“
„Bestimmt?“
„Ganz bestimmt.“
Mit Hut und Mantel trat er hinaus in die Nacht. Der Mond stand hinter einer Schleierwolke und schien milchig. Er gab das einzige Licht weit und breit. Krells Augen passten sich schnell an, sodass er zumindest Schemen ausmachen konnte. Die Verdunklungspflicht galt seit Kriegsbeginn, seit anderthalb Jahren, Zeit genug, sich daran zu gewöhnen. Die Bewohner ihrer Siedlung hielten sich streng daran, nicht so sehr, weil der Blockwart sie kontrollierte und strenge Strafen aussprach, sondern weil niemand wollte, dass sein Haus aus der Luft gesehen wurde. Die Flugzeuge der Tommys kamen vornehmlich nachts, die Piloten setzten darauf, zu dieser Zeit die deutsche Flak zu unterlaufen.
Krells Opel stand vor der Tür. Nach Vorschrift hatte er die Lampen zu schmalen Schlitzen verklebt. Bei der nächtlichen Fahrt würde ihr Strahl ihm kaum nützen, aber er fuhr den Weg jeden Tag und würde ihn finden, auch ohne viel zu sehen. In den Straßen war es stockfinster, in keinem der Häuser brannte auch nur das kleinste Lämpchen. Der Mond war inzwischen von einer dichteren Wolke verdeckt.
Krell bog auf die Landstraße. Von nun an ging es praktisch nur noch geradeaus. Erst am Backsteinbau des Altonaer Bahnhofs hielt er sich südwärts, Richtung Elbe. Vor ihm tauchte der Schornstein der Sankt-Pauli-Brauerei auf. Ein Peterwagen, mit zwei Rädern auf einem Bürgersteig abgestellt, zeigte ihm, dass er angekommen war. Auch an diesem Auto waren die Lampen ausgeschaltet. Die Regeln galten für die Polizei genauso wie für alle anderen. Nachts durfte man nicht einmal das Blaulicht anstellen, selbst in Notfällen nicht.
Krell parkte hinter dem Peterwagen und schritt durch eine Einfahrt, die aus zwei Backsteinpfeilern bestand. Vor ihm lag ein düsterer Hof mit einem Boden aus gestampftem Lehm, trocken und staubig, denn es hatte, untypisch für Hamburg, lange nicht geregnet. Das war ein Vorteil, falls es Spuren gab. Außerdem schonte es seine Schuhe; nichts klumpte und verdreckte mehr als aufgeweichter Lehm. Am Ende des Hofes machte er die Konturen eines Schuppens aus und sah beim Näherkommen, dass er wie ein Kaninchenstall aus ungehobelten Brettern bestand, die auf einem knöchelhohen Fundament aus Steinen aufgerichtet waren. Das Dach war ebenfalls aus Holz, mit ein wenig Teerpappe darüber. Die Schuppentür stand offen, die beiden Schupos hatten sich wie zwei Torwächter davor postiert. Sie rauchten, was Krell nicht passte, weil die Spurensicherung ihre Kippen dem Täter zuordnen würde. Er ging weiter. Der gesamte Platz hatte etwas Gespenstisches, wie ein Friedhof bei Nacht. Kein guter Ort zum Sterben.
Er nickte den beiden Schupos zu und sagte „Moin.“
Sie grüßten zurück.
„Wer hat ihn gefunden?“
Die zwei sahen aus wie Brüder, beide groß gewachsen, hager und kahl. „Wir“, sagte der ältere und ranghöhere der beiden. „Es gab einen Anruf auf der Wache.“ Er sprach breites Hamburgerisch.
„Von wem?“
„Anonym. Eine Frauenstimme. Das hat der Kollege, der das Gespräch entgegengenommen hat, jedenfalls gesagt. Na und dann sind wir hergefahren und haben ihn gefunden. Der hatte wohl keine Lust mehr. Wir haben Ihre Dienststelle angerufen.“
„Von dem Fernsprecher da vorne.“ Der Jüngere zeigte in Richtung auf die Hafenstraße und die Landungsbrücken. Krell schaute dorthin, aber es war kaum etwas zu erkennen, der Hafen lag genauso im Dunklen wie der Rest der Stadt, bestenfalls ein paar Umrisse waren auszumachen. Auch bei Tageslicht gab es dort nicht mehr viel zu sehen, denn Handelsschiffe machten nur noch selten fest. Die zivile Seefahrt war wegen des Krieges weitgehend eingestellt. In der Elbmündung hatten die Briten Minen abgeworfen, in der Nordsee genauso.
Krell forderte die Schupos auf, das Rauchen einzustellen und ihre ausgedrückten Kippen aufzulesen. Dann trat er in den Schuppen. Da drin war es noch dunkler, weil der Mond, so schwach er auch leuchtete, nicht hereinschien. Krells Augen mussten sich wieder umstellen, und bis es so weit war, hörte er nur das surrende Geräusch von Fliegen und roch den Geruch nach Feuchtigkeit, nach Moder, der streng war, obwohl die Tür offenstand. Krell war versucht, sich die Nase zuzuhalten. Als er zumindest ein paar Konturen wahrnehmen konnte, blieb der Eindruck eines schäbigen Ortes, selbst für Sankt-Pauli-Verhältnisse. Für einen Schuppen war der Raum zu groß, eher handelte es sich um eine kleine Lagerhalle. Möglicherweise gehörte sie zur Brauerei, war aber offensichtlich nicht in Betrieb, denn sie stand leer. Eine schwarze Lampe baumelte von der Decke. Der Fußboden bestand auch hier aus gestampftem Lehm. Die Bretterwände hatten daumenbreite Fugen, die Schiebetür rollte auf einer rostigen Schiene. Spinnen hatten sich breit gemacht, ihre Netze hingen in den Ecken und vor dem Fenster.
Er knipste seine Taschenlampe an und beleuchtete den Mann am Boden. Während er ihn betrachtete, kehrte der Gedanke zurück, den er beim Rasieren vor dem Spiegel gehabt hatte. Er war bei dieser Arbeit in seinem Element, sie war ein Teil von ihm, über ihr konnte er vieles, oft sogar alles andere vergessen. Man musste nicht jubeln, wenn man mitten in der Nacht irgendwo auf Sankt Pauli vor einem Leichnam stand, aber beklagen brauchte man sich auch nicht.
Auf den ersten Blick sah er, dass der Tote sich nicht selbst das Leben genommen hatte, wie die Schupos vermutet hatten. Ein Selbstmord war das sicher nicht. Die Pistole lag zwar in der Hand des Toten, der Lauf zeigte aber Richtung Becken. Hätte er sich im Stehen erschossen, in den Kopf, wo die Wunde war, wäre die Waffe heruntergefallen und läge irgendwo in der Nähe. Wenn er sich aber vorher hingelegt und dann abgedrückt hätte – was schon unwahrscheinlich genug war, niemand legte sich gerne in den Dreck, auch nicht in seinen letzten Minuten –, dann hätte der Arm mit der Waffe in der Hand diese Bewegung zum Becken hin nicht mehr ausführen können. Und selbst wenn der Mann nach dem Schuss noch einen Rest Leben in sich gehabt und den Arm bewegt hätte, müsste es eine Spur im Staub geben. Die fehlte aber. Nein, hier wollte jemand die Polizei auf eine falsche Fährte locken, höchstwahrscheinlich der Mörder. Bei den beiden Schupos war es ihm auch gelungen.
Krell besah sich den Toten genauer. Die eine Hälfte des Kopfes war durch den Einschuss ziemlich entstellt. An der Schläfe hatte die Kugel ein kraterartiges Loch gerissen, das inzwischen mit getrocknetem Blut verklebt war. Der Einschlag war so heftig gewesen, dass das Auge herausstand und dem Gesicht, das womöglich einmal ganz ansehnlich gewesen war, etwas Abstoßendes gab, so sehr, dass man kaum hinsehen mochte. Der Mann war schmal, auch recht klein, kaum größer als einen Meter 65. Er trug einen graubraunen Anzug, an Ärmeln und Hosensaum abgestoßen, das Muster ausgebleicht, die Wolle an manchen Stellen fadenscheinig. Bei einem seiner Schuhe war die Sohle so dünn, dass das Leder bald ein Loch bekommen hätte. Ein Hafenarbeiter war er nicht, die trugen ihre blauen Hosen und Drillichjacken, und für körperliche Arbeit wäre der Tote sowieso zu schmächtig gewesen. Krell verortete ihn eher auf die Reeperbahn. Ein Animateur an einer Lokaltür vielleicht oder ein Hausmeister in irgendeinem Etablissement. Womöglich ein Arbeitsloser, der sich an der Wehrmacht genauso wie an staatlichen Arbeitsprogrammen vorbeigemogelt hatte. Was mochte so einer ausgefressen haben, dass ihn jemand mit Vorsatz und Planung getötet hatte? Das würde die Frage sein, die ihn auf die Spur des Täters brachte, denn nach einem eskalierten Streit, nach Wut und Prügel und schließlich einer Pistole, sah die Situation nicht aus. So etwas erledigte man direkt vor Ort, dafür ging man nicht in einen Schuppen fernab der Hauptstraße.
Krell zog seine Taschenuhr heraus. Es war inzwischen 2.30 Uhr. Man konnte nicht abschätzen, wann die Kollegen von der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin eintreffen würden, unterbesetzt wie sie waren. Es war überall dasselbe, Mitarbeiter hatten sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, waren eingezogen oder in die eroberten Länder versetzt worden, und den Aderlass merkte man inzwischen bei allen Dienststellen der öffentlichen Verwaltung, auch bei der Polizei. Gejammert wurde trotzdem nicht, auch Krell verbot es sich. Es galt, mit dem klarzukommen, was war, und das Beste daraus zu machen.
Immerhin traf Schubert ein, sein Kriminalassistent. Er streckte den rechten Arm aus. „Heil Hitler.“
Krell nickte ihm zu, während die Schupos mit den gleichen Worten und ebenfalls ausgestreckten Armen grüßten, wie es deutschen Beamten vorgeschrieben war.
„Wir warten auf die Kollegen von der Technik?“, fragte Schubert, nachdem er einen Blick auf die Leiche geworfen hatte.
„Ja“, erwiderte Krell. Er hielt die Hand vor den Mund, damit Schubert nicht sah, dass er gähnte. „Nach Lage der Dinge kann das allerdings dauern.“
„Wenn Sie wollen“, schlug Schubert vor, „greife ich dem Mann mal vorsichtig in die Jackentaschen. Vielleicht erfahren wir so, wer er war.“
Krell gab nicht gleich eine Antwort. Ein solches Vorgehen verstieß eindeutig gegen die Dienstvorschrift. Er schaute seinen Assistenten an. Schubert mochte um die 30 sein, wirkte aber älter, weil er weitgehend kahl war. Er war ein Provinzei irgendwo aus dem Holsteinischen und noch nicht lange dabei, trotzdem hielt Krell ihn schon jetzt für einen besseren Bewerber als die meisten jungen Männer, die er in den letzten Jahren erlebt hatte. Schubert stellte sich geschickt an und dachte mit, und er wirkte auch intelligent, wozu vor allem seine Nickelbrille beitrug, die ihn ein wenig wie einen Professor, zumindest wie einen Lehrer aussehen ließ. In nicht allzu langer Zeit würde der Assistent einen guten Kommissar abgeben, aller Wahrscheinlichkeit nach bei der Hamburger Kripo. Es gab keinen Grund für ihn, woanders hinzugehen, und eingezogen wurde er nicht mehr. Er war 1939 beim Polenfeldzug dabei gewesen und angeschossen worden, ausgerechnet ins Knie. Jetzt war es steif. Er zog das Bein nicht nach, machte aber beim Auftreten jedes Mal eine seltsame Bewegung, als drehe er das kaputte Gelenk von außen nach innen. Es sah fast wie ein Tanzschritt aus.
Krell nickte. „Also los.“
Schubert stellte sich breitbeinig über den Leichnam und beugte sich herunter, wobei sein Rücken gerade blieb, fast wie ein Brett. Beide Knie hielt er durchgedrückt. Krell hatte sich inzwischen daran gewöhnt, dass seine Haltung manchmal seltsam aussah, genauso wie er akzeptiert hatte, dass Schubert nicht in der Lage war, einem Verbrecher zu Fuß zu verfolgen. Viel wichtiger war, dass er Aufgaben wie die jetzige gewissenhaft erledigte. Vornübergebeugt knöpfte er dem Mann vorsichtig das Sakko auf und griff mit spitzen Fingern erst in die linke, dann in die rechte Innentasche. In beiden fand er nichts, woraufhin er die Außentaschen betastete, die jedoch ebenfalls leer waren.
Er kam wieder hoch. „Die Hose auch?“
Krell seufzte und drehte den Kopf und Hals zur Seite. Es gefiel ihm ganz und gar nicht, seinen Segen zu einem derart vorschriftswidrigen Tun zu geben. Die Regel war eindeutig: Man hatte einen Leichnam unberührt liegen zu lassen, bis das Umfeld nach Hinweisen abgesucht und er von allen Seiten fotografiert worden war. Allerdings bedeutete es eine kolossale Zeitverschwendung, stundenlang auf die Spurensicherung und den Arzt zu warten. Womöglich arbeiteten die Abteilungen nachts gar nicht mehr, dann würden sie bis zum Morgen hier herumstehen müssen. Die Zeit konnte man besser nutzen, zum Beispiel die Kartei nach Vermissten durchforsten und sich dann einen Plan für die Ermittlung machen.
„Doppelt so vorsichtig“, sagte er.
Nur mit Zeige- und Mittelfinger strich Schubert über die vorderen Hosentaschen. Aber die, auf die es ankam – wo Männer ihre Brieftaschen trugen, wenn sie sie nicht im Sakko hatten –, waren hinten. Ohne Krells Hilfe würde es nicht gehen. Er kam sich vor, als plante er etwas Verbotenes, und so war es ja auch. Die Aufmerksamkeit der Schupos hatten sie bereits erregt, die beiden langen Kerle sahen ihnen aus sicherem Abstand zu. Selbst wenn sie nicht die Hellsten waren, musste ihnen klar sein, dass der Kommissar und sein Assistent gegen die Vorschriften handelten. Also waren sie nun auch noch ein schlechtes Vorbild.
Und dennoch trat Krell heran und ging neben Schubert – und neben der Leiche – in die Hocke. Während er die Bewegung vollzog, wurde ihm bewusst, dass sie für Schubert unmöglich war. Krell war heilfroh, dass er unversehrt war. Auch er war im Krieg gewesen, damals, 1917 und 1918. Aber er war mit heilen Knochen zurückgekehrt.
„Sie ziehen hier am Gürtel“, sagte er. „Schön langsam, ja? Er braucht nur ein kleines bisschen hochzukommen.“
Er hätte ihn nicht ermahnen müssen, Schubert blieb trotz seiner vorgebeugten Haltung auch bei diesem Handgriff ausgesprochen vorsichtig. Krell tastete die linke hintere Tasche ab, dann wiederholten sie die Prozedur auf der anderen Seite.
Es war nichts zu finden. Krell schüttelte den Kopf.
„So ’n Schiet“, sagte Schubert, als sie wieder aufrecht standen.
„Wohl wahr.“