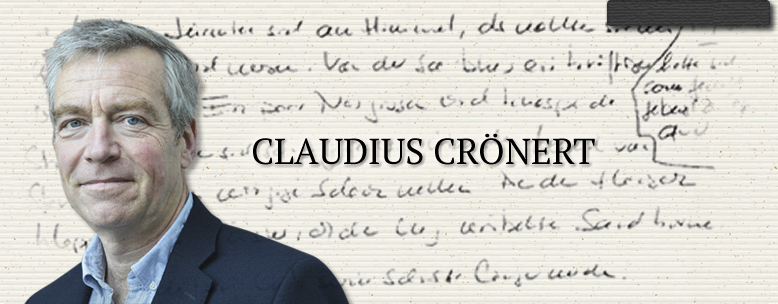1
Keiner von uns mochte Heinrich Monte.
Er wirkte genauso abweisend wie die düsteren Säle im Kloster, die nach Weihrauch stanken, nach altem Schweiß und Buße. Selbst in den kurzen Zeiten, die dem Reden vorbehalten waren, sprach er kaum. Unsere Bedürfnisse nach Wärme und Nähe waren nicht seine. Er schien uns dafür zu verachten. Was immer uns umtrieb, scherte ihn nicht, er blieb für sich. Fast hätte man ihn der Seite der Mönche zurechnen können. Auf dem Feld verrichtete er seine Arbeit ordentlich, seine Mahlzeiten nahm er schweigend ein, und beim Beten starrte er vor sich hin – vielleicht dorthin, wo er Erlösung vermutete. Doch irgendetwas war an ihm, dass auch die Mönche misstrauisch machte. Ich glaube, sie bezweifelten einfach, dass er zu dem gleichen Gott betete wie sie.
Als Klosterschüler von vierzehn Jahren war Heinrich größer als die meisten Ordensbrüder. Er hatte einen muskulösen Oberkörper und seine Oberarme wölbten sich, wenn er arbeitete. Den Kopf hielt er stets erhoben. Am auffälligsten aber waren seine kräftigen Kiefer und das ausgeprägte Kinn.
Bei der Ankunft im Kloster von Magdeburg, sieben Jahre zuvor, hatte er wie alle anderen den Eid auf die drei Tugenden Gehorsam, Keuschheit und Armut leisten müssen. Doch schien er damals schon gewusst zu haben, dass ein Schwur, zu dem man gezwungen wird, nicht gilt. Er war nicht gehorsam. Sein Gang, seine ganze Haltung machten klar, dass er nur einen einzigen Herrn anerkannte: sich selbst.
Seine dunklen Augen saßen tief in den Höhlen, und wenn er einen ansah, kam sein Blick wie aus großer Ferne.
Er war uns so fremd wie wir ihm.
Ich selbst hatte, obgleich unsere Strohsäcke im Schlafsaal nebeneinanderlagen, überhaupt keine Verbindung zu ihm. Zwischen uns gab es kein Nicken und kein Augenzwinkern, gar nichts. Dabei kannten wir einander gut und waren auch nicht verfeindet.
So kam es, dass mein bester Freund im Kloster ein Galinder war – die Mönche hatten ihn Ludger getauft –, obwohl Heinrich Monte nicht nur vom gleichen Stamm war wie ich, sondern sogar aus demselben Dorf stammte. Mit Ludger verstand ich mich, auch ohne die Worte, die im Kloster verboten waren.
Die Seite von Heinrich ergriff ich bestenfalls dann, wenn er einen seiner Kämpfe mit den Mönchen ausfocht. Schon damals konnte Monte stur sein wie ein Esel. Wenn er etwas nicht wollte – eine lateinische Deklination zum zehnten Mal nachsprechen oder Schnee schippen, obwohl es noch schneite, Brennholz umstapeln, auch wenn es ordentlich lag oder ohne Grund zur Beichte gehen –, konnten die Brüder ihn nicht zwingen. Sie bestraften ihn. Er ertrug es. Sie entzogen ihm den Wein oder gleich das ganze Essen, peitschten ihn aus und sperrten ihn in die Zelle im Keller, die wir das Loch nannten. Ich hoffte für ihn auf Milde, betete sogar manchmal dafür, aber ihm schien all das nicht viel anzuhaben. Wenn die Strafe – die in seinem Fall der Abt persönlich festzusetzen pflegte – abgelaufen war, kam Heinrich zurück, den Kopf erhoben wie immer, und starrte in die Ferne. Mochte sein Rücken auch blutig sein, gebeugt war er nicht.
Dass Heinrich sehr wohl auf mich achtete, wurde mir erst klar, als ich selbst in das Visier unseres Lehrers Bruder Simon geriet. Simon war im ersten Jahr im Magdeburger Kloster, einer der jüngeren Mönche. Er war groß und schmal, hatte Locken und schon ein paar Falten auf der Stirn. Seine Stimme war sanft, ich habe ihn nur selten wütend gehört. Uns unterrichtete er in Geographie, Mathematik, Philosophie und Latein.
Eines Tages war er überzeugt, dass ich mit meinem Nachbarn Ludger gesprochen hätte. Wir saßen auf niedrigen Schemeln, immer zwei nebeneinander. Es war kalt im Saal, nur ein paar Kerzen brannten, aber kein Feuer. Bruder Simon, die Hände vor dem Bauch gefaltet, sprach über die Logik, die er die Kunst der Künste nannte, und besonders über den logischen Schluss: „Kein Rechteck ist ein Kreis. Alle Quadrate sind Rechtecke. Also ist kein Quadrat ein Kreis.“
Mag sein, dass ich Ludger einen Blick zugeworfen, vielleicht sogar das Gesicht verzogen habe angesichts dieser umwerfenden Schlussfolgerung. Gesagt habe ich ganz sicher nichts.
„Nikolaus“, erklärte er, und seine Stimme klang, als segne er mich, „die Schüler sprechen nicht ungefragt während des Unterrichts. Wir alle sprechen überhaupt nicht ungefragt im Kloster, es sei denn im Parlatorium, und auch dort nur zu den festgesetzten Zeiten. Komm bitte nachher auf mein Zimmer. Ich
möchte, dass du – zu deinem Besten – dieses Gebot verstehst. Ein Gebot Gottes.“
Bruder Simon war kaum in unser Kloster eingetreten, da ging bereits das Gerücht, er verhalte sich unkeusch gegen die Schüler. In jenem Augenblick, als er mich zu sich bestellte, dachte wahrscheinlich jeder das Gleiche wie ich. Die in meiner Nähe saßen, warfen mir Blicke zu, entsetzt die einen, mitleidig die anderen. Ein blonder Junge, den sie Christian getauft hatten und der einige Jahre jünger war als ich, hatte die Augen weit aufgerissen. Den Gerüchten zufolge wurde Christian regelmäßig zu Bruder Simon bestellt, und als ich an diesem Morgen den Schrecken in seinem Gesicht wahrnahm, glaubte ich sie. Er wusste, was mir drohte.
An jenem Vormittag konnte ich an nichts anderes mehr denken. Nach dem Mittagsgebet hatten wir Ruhezeit. In der Regel schliefen wir sofort ein, – das erste Gebet war ja schon um 2 Uhr morgens -, aber auch auf dem Strohsack ließen mir mein Verstand und die Angst keine Pause. Mein Herz schlug laut. Mit den anderen betete ich noch die Non, das Gebet genau auf der Hälfte zwischen Mittag und Sonnenuntergang, dann machte ich mich auf zu Bruder Simon. Inzwischen hatte ich gründlich über die Angelegenheit nachgedacht. Meine Entscheidung stand fest. Verweigerte ich mich, würden die Strafen nur noch schlimmer sein.
Es war März. Die grauen Klostermauern strahlten immer noch Kälte und Feuchtigkeit ab, die Sonne schien zu jener Jahreszeit nie in den Hof. Im Kreuzgang war die Eisschicht schon etwas dünner geworden. Auf ihr lagen kleine Pfützen, und das Wasser hatte sich mit dem Streusand zu einer braunen Brühe vermischt. Wir waren durch die langen Wintermonate an die Kälte gewöhnt. Jetzt empfanden wir sie nicht mehr. Ein paar Wochen noch, dann war der Frühling da.
Als ich vor der Tür von Bruder Simons Kammer stand, war meine Kehle trocken. Ich wäre am liebsten davongelaufen. Doch ich zwang mich zu bleiben. Um mich zu beruhigen, strich ich mit dem Finger über die schmiedeeiserne Strebe der Tür.
Andere, sagte ich mir, haben auch durchgemacht, was du gleich erleben wirst, so schlimm wird es schon nicht werden. Doch dass sich mein ganzer Körper – und besonders der After – zusammenzog, konnte ich nicht verhindern, genauso wenig, dass mir ein Schauer über den Rücken lief lief. Ich dachte noch einmal daran, ungehorsam zu sein. Die Peitsche – und dann die Zelle im Keller, das Loch, in das Simon jederzeit kommen konnte. Niemand hätte ihn oder meine Schreie gehört. Nein, , es blieb dabei,wegzulaufen machte alles nur noch schlimmer.
Ich klopfte.
„Herein“, hörte ich die sanfte Stimme und schob die Tür auf.
Er stand am Fenster, ein Pergament in der Hand, und drehte sich zu mir. Dabei tat er überrascht. „Ah, Nikolaus, schön, dass du gekommen bist. Tritt näher. Und schließ die Tür.“
Im Zimmer gab es ein schmales Bett, einen Holztisch mit einem Stuhl und zwei Bretter an der Wand. Auf dem unteren standen ein paar ledergebundene Handschriften, auf dem oberen lagen eine Peitsche, wie sie manche Mönche zur Selbstgeißelung benutzten, und ein dunkles Holzkreuz, und mein Gedanke war: wie kan ein so dünnes Brett ein so schweres Kreuz tragen?
Simons Nase war ein wenig gerötet. Sicher hatte er seine Tagesration Wein bereits getrunken. Als er vor mir stand, konnte ich den Alkohol riechen.
„Du weißt, warum du hier bist?“
Er hatte die Hände ineinandergelegt und musterte mich. Seine Lippen, sein Gesicht, alles war reglos, und ich hatte keine Vorstellung davon, was in ihm vorging. Seiner Sanftheit traute ich nicht.
„Nun, willst du nicht antworten?“
In den vielen Tagen im Kloster hatte ich die Erfahrung gemacht, dass es das Beste war, nichts zu sagen. Man widersprach nicht, aber man vergab sich auch nichts.
„Ja, jetzt kannst du schweigen. Aber das verlange ich auch im Unterricht von dir.“ Seine kleinen braunen Augen blickten mich an. „Mein lieber Nikolaus, das weißt du doch. Nicht wahr?“
Er nahm meine Hand.
„Ich bin davon überzeugt, du verstehst, was ich meine und wirst es schnell und für immer lernen. Deshalb brauchst du meinet-wegen keine Strafe zu bekommen. Ich muss dein Vergehen nicht einmal dem Abt melden. Letztlich …“ Er hob die Schultern, und auf seinen Mund trat ein Grinsen, wie eine Vorfreude. „…hängt das allein an dir.“
Sein Daumen fuhr über meinen Handrücken. Meine Kehle wurde noch trockener. Es lag mir auf der Zunge, ihn an die Keuschheit zu erinnern, ein Gebot, das im Kloster mindestens so wichtig war wie das Schweigen. Doch ein Schüler erinnerte einen Mönch an nichts und erst recht nicht einer wie ich, den sie für einen Heiden hielten.
Bruder Simon zog mich zu sich und legte mir den Arm um die Hüfte. Ich spürte seine Hand durch meine Kutte.
„Du bist ein hübscher Junge, Nikolaus, das ist mir gleich aufgefallen. Weißt du, wie die Botschaft heißt, die Jesus Christus der Welt geschenkt hat? Na, weißt du es?“
Ich war wie gelähmt und schüttelte den Kopf.
„Es ist die Botschaft der Liebe, du guter Junge.“
Er zog mich noch näher zu sich heran. Seine Augen
zwinkerten. Über der Stirn fehlten ihm Haare, doch ein Büschel war stehengeblieben, damit versuchte er, die Löcher
zu kaschieren. Sein Atem ging schnell und roch so faulig, als sei der Wein in seinem Mund vergoren. Dann ließ er meine Hand los und legte mir auch den anderen Arm um die Hüfte.
„Die Botschaft der Liebe“, wiederholte er. „Die hat es vor unserem Herrn nicht auf der Welt gegeben. Da herrschten nur Sünde, Mord und Totschlag. Mit Jesus Christus kam die Vergebung – so wie ich dir heute vergebe. Und die Liebe. Die Menschen sollen einander lieben, das hat er uns gelehrt.“
Er stand nun ganz dicht vor mir, so dass unsere Körper sich berührten. Etwas Hartes drückte gegen mein Becken. Mit der Hand strich er mir über den Hinterkopf.
Mich schauderte.
„Nikolaus“, flüsterte er.
Dann presste er seinen feuchten Mund auf meinen. Seine Zunge fuhr mir über die Lippen, und ich spürte etwas Kaltes und Nasses im Gesicht. Ekel erfasste mich und ließ mich erzittern. Ohne nachzudenken stieß ich ihn mit beiden Händen von mir. Er wankte und stolperte und versuchte, sich zu fangen. Erst am Tisch fand er Halt.
Es dauerte einen Moment, bis er begriffen hatte, was passiert war. Er schüttelte den Kopf , dabei sagte er: „Nikolaus“ und wirkte traurig.
Bitten um Vergebung schossen mir in den Sinn. Ich sah mich vor ihm niederknien. Doch ich bekam den Mund nicht auf. Wie gelähmt stand ich da, während er auf das Regal zuging. Mein erster Gedanke war: Jetzt nimmt er die Peitsche. Aber er griff nach dem Holzkreuz. Sein Arm sackte unter dem Gewicht nach unten. Er musste die andere Hand zu Hilfe nehmen.
„Nikolaus, gerade dich hätte ich für klüger gehalten. Aber ihr Heiden aus dem Prussenlande, ihr habt eben nicht viel Verstand.“
Ich wollte etwas erwidern, um ihn milder zu stimmen, und öffnete den Mund. Dabei riss mir die Lippe auf. Ich brachte kein Wort heraus.
Er kam mit dem Kreuz in der Hand auf mich zu und hob es in die Höhe, als sei ich ein böser Geist. Ich machte ein paar Schritte zur Seite und packte den Stuhl, den ich vor mich hielt.
„Ach, der kleine Heide will kämpfen. Das wollen wir mal sehen.“
Bruder Simon drehte sich um und wischte mit dem Holzkreuz die Handschriften von seinem Regalbrett. Krachend fielen sie zu Boden. Im gleichen Moment begann er um Hilfe zu rufen.
Ich ahnte, dass nun der Kellermeister hereinstürmen würde, und vielleicht einer der Laienbrüder. Und dass ich dann würde erklären können, was ich wollte, an den beschädigten Handschriften und an der Unordnung im Zimmer würde man mir die Schuld geben. Verkrampft hielt ich mich am Stuhl fest.
Doch dann stand Heinrich Monte in der Tür.
Er musste in der Nähe gewesen sein. Vielleicht sogar dort gewartet haben.
„Gut, dass du kommst, Monte. Nikolaus hat mein Zimmer verwüstet. Halt ihm die Arme fest.“
Heinrich ließ seinen Blick durchs Zimmer schweifen.
„Das kann nicht sein. Du stehst am Regal und hast das Kreuz in der Hand. Nikolaus ist auf der anderen Seite des Tisches und schützt sich mit dem Stuhl. Warum hättet ihr umeinander herumlaufen sollen?“
„Weil … weil … Was redest du da? Ich bin ein Mönch. Zweifelst du etwa an meinem Wort?“
Simon begann erneut, um Hilfe zu schreien.
Heinrich stieß mit dem Fuß die Tür zu. „Halt den Mund“, befahl er und ging auf Simon zu.
Bruder Simon sprang in meine Richtung wie ein in die Enge getriebenes Tier. Instinktiv hob ich den Stuhl wieder in die Höhe. Mag sein, dass er das als Angriff deutete – ich weiß es nicht, ich wollte nur mein Gesicht schützen. Im nächsten Augenblick traf mich eine Kante des Kreuzes am Knie. Ein Knochen knackte, und der Schmerz schoss mir ins Hirn. Mir wurde schwarz vor Augen, ich fürchtete zu fallen. Den Stuhl ließ ich los, stützte mich aber mit beiden Händen auf die Tischplatte. Ich sah noch, wie Heinrich Bruder Simon an der Kutte packte und niederstieß und wie die Zimmertür aufgerissen wurde. Diesmal war es wirklich der Kellermeister, gefolgt von zwei Laienbrüdern.
Weitere Leseproben:
Freyas Land - Rachemelodie - Die Herren der Schwerter - Das Kreuz der Hugenotten - Made in HH - Siegeszeichen