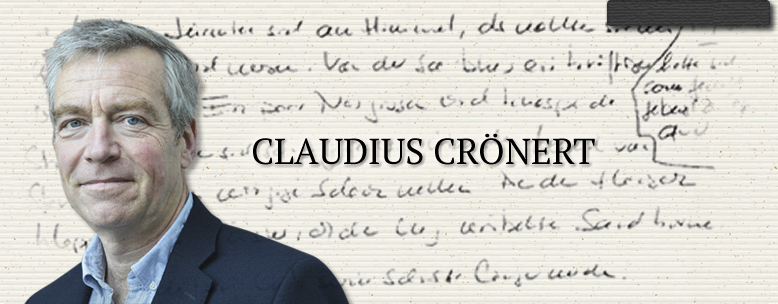1
Augen zu und durch. Zum dritten Mal innerhalb einer Stunde ging Martha Bankar dieser Satz durch den Kopf, vier Worte, die sie in keinem ihrer Texte geduldet hätte. Eine Phrase – doch eine, die ihre Stimmung genau traf.
Wie immer strich sie im Vorbeigehen mit dem Finger über das Metallschild am Eingang. Da waren sie alle aufgelistet, rote Schrift auf weißem Grund, die Zeitschriften des Kronos-Verlages. Eine für das Fernsehprogramm, eine nur für Männer – Erfolg, Muskeln, Potenz –, eine Klatschzeitschrift, leicht angestaubt, dann eine für junge Frauen, ein Seglerheft und ein Computermagazin. Und schließlich, ganz unten und auf einem Extraschild, die Spot. Das Blatt für einen zweiten Blick. Neuerwerbung und Zuschussgeschäft des Verlegers. Sein Stiefkind.
Martha liebte die Morgenstunden in der Spot-Redaktion, ohne Mails und Flurgequatsche, ohne Konferenzen und Telefon. In den ersten beiden Stunden schaffte sie oft mehr als am ganzen restlichen Tag. Sie hatte sich einen Zwischenspurt vorgenommen. Bis zum Mittag wollte sie einen ordentlichen Teil ihrer Arbeit erledigen. Dann würde ein Ende in Sicht kommen.
Sie hielt ihre Jacke in der Hand, die Tasche in der anderen und drückte mit der Schulter gegen die Glastür, die sich nach innen öffnete. Der Pförtner rief ihr sein übliches »Moin Moin« entgegen. Sie nahm den Fahrstuhl hinauf in die fünfte Etage.
Auf ihrem Schreibtisch breitete sie ihre Unterlagen aus, den Notizblock, ein paar Karteikarten, die Skizzen. Sie saß an einer Reportage über bürgerschaftliches Engagement und Sponsoring. Als Beispiel diente die Elbphilharmonie hier in der Stadt; aber auch die Dresdner Frauenkirche und das Berliner Stadtschloss. Die Idee stammte von ihrem Chefredakteur. Martha fand sie langweilig. Deshalb musste sie sich zwingen.
Sie hatte ein paar Interviews geführt, mit Unternehmergattinnen, die sich in Understatement übten, mit Kulturmanagern, die um die Unabhängigkeit ihrer Häuser fürchteten, mit einem Senator voller Berufsoptimismus.
Martha verlangte Aufmerksamkeit von sich. Sie brauchte eine Gliederung. Es gehörte, sagte sie sich, zu ihrem Beruf, über Themen zu schreiben, an denen das Herz nicht hing. Mit anderen Artikeln hatte sie Aufsehen erregt. Hatte einen Preis gewonnen mit dem Porträt eines Rathaus-Hausmeisters, in dem sie zeigte, wie weit sich einfache Bürger und politische Klasse im Denken und Sprechen voneinander entfernt hatten. Ihre Reportage über Straßenkinder in St. Georg, rund um den Hauptbahnhof, hatte eine Bürgerschaftsdebatte ausgelöst und ein paar Euro für Hygiene und Notunterkünfte gebracht.
Nun also die Reichen, die für ein neues Konzerthaus spendeten.
Sie hatte die Interviews abgehört, zitierenswerte Aussagen abgeschrieben und dachte darüber nach, was fehlte und wie sie den Stoff ordnen sollte. Aber ein guter Gedanke stellte sich nicht ein. Sie wurde unruhig und stand auf, dann machte sie sich auf den Weg in die Küche, wo sie sich Kaffee holte.
Den Rückweg kreuzte ihr Chefredakteur Braun, einen Stapel Akten unterm Arm. »Heribert, was machst du denn schon so früh?«
Braun hob seine Akten in die Höhe. »Auf dem Weg zum Verleger.« Er legte die Stirn in Falten und zog das nächste Wort auseinander: »Strategiegespräch. Sein Höllenhund ist auch dabei, dieser Zahlenknecht von einem Wirtschaftsprüfer.«
»Und du – du kämpfst für die Spot?«
»Worauf du einen lassen kannst.« Er grinste. »Für die Spot im Allgemeinen und für meine Lieblingsautorin im Besonderen.«
Er war Mitte fünfzig, die Haare grau, der Bart zwar gestutzt, aber trotzdem zottelig, eine breite, gold gerandete Brille auf der Nase. Seine Bürokleidung bestand aus einer ausgebeulten Cordhose und einem gestreiften Hemd, dessen Brusttasche sich wölbte, weil er ein mobiles Büro in ihr verwahrte. Sie wusste, dass sich niemand darum scherte – er am allerwenigsten –, in welchem Aufzug er zum Verleger ging. Seine Qualitäten waren anerkannt. Er hatte die Spot aufgebaut, mit wenig Geld und viel Engagement, mit feinen Reportagen und ungewohntem Layout, ein einzigartiges Blatt in der deutschen Presselandschaft.
Als die Verluste zu groß wurden, hatte der damalige Besitzer die Spot verkauft. Wie weit würde Heribert gehen, um sie zu erhalten?
»Wir wären besser selbständig geblieben«, entfuhr es ihr.
»Richtig. Und hätten ohne Salär gearbeitet und uns abwechselnd und gegenseitig geliebt, und die Sonne hätte geschienen, und die Läden in der Nachbarschaft hätten uns ihre Reste geschenkt. Ach wäre das schön gewesen.«
Sie schmunzelte. Dann sagte sie: »Immer noch besser als Stoffe nur danach auszusuchen, ob sie sich verkaufen.«
Er zog Luft durch die Zähne, ein lautes, ironisches Geräusch. »Wir sind beim Thema. Was macht deine Reportage?«
Sie gab sich Mühe, ihm seine Ironie zurückzugeben, betonte ihre Worte und streckte den Satz: »Unser Heft wird in vielen guten Häusern gekauft werden. Und in teuren Friseursalons liegen.«
»Und hoffentlich jede Menge Abonnenten gewinnen«, sagte er. »Denn das ist das, was die hohen Herren von ihrem Schreiberling erwarten. Alternativ darf er ihre Verluste ausgleichen.«
Er grinste, deutete mit seinen Akten ein Winken an und zog weiter. Martha kehrte zu ihrem Platz zurück. Sie hielt ihren Kaffeebecher mit beiden Händen umklammert, legte die Füße auf einen Beistelltisch und den Kopf in den Nacken. Sie war versucht, Braun und der Auflage zuliebe zu schreiben, was die Elb- und Alsteranrainer lesen wollten, selbstloses Engagement zu loben, über den Glasbau der neuen Philharmonie zu jubeln. Eine Heimatgeschichte aus dem Bilderbuch. Sie verwarf den Gedanken. Ihre Leser sollten weiterhin Spot-Geschichten bekommen. Sie würde über den Rückzug des Staates sprechen, über die Chancen, die sich ergaben, aber auch über die Sorge, dass Provokatives es noch schwerer haben würde.
Ihr Telefon klingelte. Sie fühlte sich gestört und nahm sich vor, das Gespräch kurz zu halten. Als sie abhob, wusste sie, wer dran war, bevor der andere zu sprechen begonnen hatte. Ein tiefer, seufzender Atmer. Diese Stimme hatte sie lange nicht gehört.
»Hier ist Mansur Bankar.« Langsam setzte er seine Wort. Er klang stolz und bemühte sich um eine feste Stimme. Sie spürte seine Sehnsucht, die sie immer gespürt hatte, wenn er redete. »Ich rufe dich an, um dir etwas mitzuteilen.«
»Was ist denn?«
Mansur machte eine Pause. Sie hörte, wie er mehrfach ansetzte und dabei schwer atmete. »Ich muss dir sagen, dass mein Sohn Said gestorben ist.« Er schluchzte auf.
»Was?« Die Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Ein Irrtum, war der stärkste, derjenige, der sich festsetzte. Das konnte nicht stimmen. »Mansur, wann? Wie ist das passiert?«
Er war nicht in der Lage zu antworten. Er schnäuzte sich, schluchzte erneut, schnäuzte sich wieder. »Die Polizei hat mich angerufen. Er ist aus dem Fenster gefallen.« Sie hörte ihn weinen. »Oder gesprungen, sagen sie. Das soll eine Untersuchung ergeben.« Seine Stimme verlor sich.
»Ich habe ihn gestern noch gesehen«, sagte Martha. Konnte es wirklich ein Irrtum sein, wenn sich die Polizei bereits eingeschaltet hatte? »Ist das heute passiert?«
»Am Morgen.« Mansur schnaubte ein weiteres Mal in sein Taschentuch, dann fasste er sich. »Ich habe dich angerufen, obwohl ihr getrennt seid. Schließlich bist du die Mutter meines Enkelkindes David.« Die Kraft, die seine Worte ihn kosteten, war greifbar. »Saids Sohn.«
»Kann ich irgendwas tun?«
»Ich habe meinen Sohn aus dem Iran nach Deutschland gebracht. Und jetzt ist er in Deutschland gestorben. Das habe ich nie gewollt.«
»Mansur …«, sagte sie. Doch da war die Leitung bereits stumm. Er hatte aufgelegt.
Sie starrte aus dem Fenster, ohne irgendetwas zu sehen oder zu denken. In ihrem Kopf war Leere und ein diffuses Rauschen. Als sie wieder zurückfand, begann sie, ihre Aufzeichnungen zusammenzuräumen und zu stapeln. Das Rauschen in ihren Ohren dauerte an. Sie stand auf. Dabei rollte ihr Stuhl davon, und sie wäre fast hingefallen. Als sie wieder sicher stand, eine Faust auf der Tischplatte, zitterten ihr die Knie und ihr Herz schlug schneller. Ihr Verstand war wieder klar.
Dem Pförtner gegenüber murmelte sie etwas von einem Termin und hörte sein »Jo, is‘ notiert, Frau Bankar. Dann man viel Erfolg.« Sie stieg ins Auto und fuhr ins Karolinenviertel, zu Saids Haus.
Die Leiche war bereits abtransportiert worden. Eine geschwungene Kreidelinie markierte den Platz, wo sie gelegen haben musste. Drumherum standen rot-weiße Polizeihütchen. Zwischen den parkenden Autos war der Bürgersteig vor dem Haus mit Plastikband abgesperrt. Zwei Polizeiwagen mit blinkenden Blaulichtern standen auf der Straße. Gegenüber hatten sich Schaulustige versammelt. Auch aus den Fenstern der stuckverzierten Häuser lehnten die Leute und starrten heraus. Männer in Uniform liefen umher.
Vor der Haustür telefonierte eine Frau und ging dabei auf und ab. Sie hatte blondes Haar, eine Dauerwelle. Ein kräftiger Typ, ihr Gang war wie ein Stampfen. Beamte kamen auf sie zu, drehten aber wieder ab, als sie sahen, dass sie beschäftigt war. Wahrscheinlich die Einsatzleiterin. Martha überlegte, sie anzusprechen. Vor vierundzwanzig Stunden hatte sie den Toten noch gesehen, vielleicht war ihre Aussage erwünscht.
Gefallen – oder gesprungen? Said hatte nicht elend gewirkt, erst recht nicht verzweifelt. Eine solche Stimmung passte nicht zu ihm. Zu ihrer gemeinsamen Zeit hatte er sich trübe Gedanken kaum je zu Herzen gehen lassen – unbegreiflich für sie. »Komm, lach mal wieder«, war ein typischer Said-Satz. Und jetzt sollte er aus dem Fenster gesprungen sein?
Ihr fielen Augenblicke ein, da schien auch ihn aller Schwung verlassen zu haben. Dann wirkte er wie in sich zusammengefallen. Aber lange hatten diese Zustände nie angedauert, ein paar Stunden höchstens, weniger als einen halben Tag. Lange genug, um sich das Leben zu nehmen? Sie schüttelte den Kopf. Trübsinnig war er gestern nicht gewesen. Sicher nicht.
Ihr Blick wanderte an der graublauen Fassade hinauf zu seinem Balkon im vierten Stock. Ihr wurde mulmig, als sie die Höhe ermaß. Der Balkon hatte ein Geländer, so hoch wie die der Nachbarwohnungen. Wie sollte Said da heruntergefallen sein? Stockbetrunken?
Die Einsatzleiterin hatte ihr Telefonat beendet und ließ ihr Handy in der Tasche verschwinden. Vor ihr wartete eine kleine Schlange Uniformierter. Sie sagte jedem ein paar Sätze, schüttelte manchmal nur den Kopf.
Martha drehte sich weg. Sie würde nicht mit dieser Frau sprechen, jetzt nicht. Vor ihr tat sich ein anderer Gang auf, ungleich schwerer. Ihr Sohn, David.
Sie stieg in ihren 190er Mercedes und ließ ihn an. Während sie mechanisch Gas gab und bremste, schaltete, blinkte und abbog, baute sich der gestrige Tag vor ihrem Auge auf. Saids Geburtstag – und gleichzeitig der letzte in seinem Leben. Mit einer Klarheit und Schärfe, die ihr fast unheimlich war, war die Erinnerung da.
Obwohl ein Sonntag, war sie früh aufgestanden. In der Küche hatte sie die Kaffeemaschine gefüllt. Dabei war ihr Blick an dem Kalender hängengeblieben, den David ihr gemalt hatte. Seine typischen Karikaturen von Gesichtern und Szenen. Der August – mit dem Bild »Zwei Faulenzer am See« – war zur Hälfte vorüber, trotzdem hielt sich die feuchte Hitze. Ein Fenster stand offen. Die Sonne schien herein, ihre Strahlen ließen die Scheibe reichlich staubig aussehen.
Sie trug ihren Schlafanzug, einen verwaschenen Zweiteiler. Die Haare hielt sie mit einem Zopfband zusammen. Kaffeeduft füllte den Raum. Als David hereinkam, war er bereits angezogen.
Sonntags blieb er oft bis in den Nachmittag im Pyjama und genoss es, in den Tag hineinzutrödeln. Er las Comics, manchmal sogar Bücher, schoss mit dem Ball gegen seine Zimmertür, bis sie es ihm verbot, und hörte Musik. Oder er zeichnete. Doch an diesem Tag hatte sein Vater Geburtstag. David war fix und fertig, gewaschen und gekämmt. Er hatte die Haare nass gemacht und einen scharfen Scheitel gezogen. Mit seiner Frisur, dem gebügelten Oberhemd und der frisch gewaschenen kurzen Hose hätte er auch zur Einschulung gehen können. Sie konnte ihre Augen kaum von ihm wenden und lachte in sich hinein.
»Ich freue mich auf Papa«, sagte er.
Martha verkniff sich einen Kommentar. David war erst neun, und sie hielt sich an ihren Vorsatz, ihm gegenüber nicht schlecht von seinem Vater zu reden. Doch im Geiste sah sie Said, wie er die Tür öffnete, verpennt und überrascht. »Was, schon so spät?«
David aß eine einzige Scheibe Brot, trank etwas Saft, dann schob er seinen Teller von sich und sagte: »Von mir aus können wir los.«
»Los? Es ist kurz nach neun. Wir sind um elf eingeladen.«
»Erst um elf? Was soll ich denn so lange machen?«
»Hausaufgaben zum Beispiel.« Sie biss in ihr Brot.
»Heute ist Sonntag.«
Sie kaute, während sie antwortete: »Und das heißt: Morgen ist wieder Schule. Hast du alles fertig oder nicht?«
»Hab ich«, erwiderte der Junge.
»Deine Geschenke eingepackt?«
»Schon längst.«
Sie wusste, das stimmte. David hatte seinem Vater Teile fürs Fahrrad gekauft, eine Luftpumpe und je eine Lampe für vorne und hinten. Das, was Papas Rad nach seinem Ordnungssinn fehlte. Er hatte dafür einen Großteil seines Taschengeldes geopfert und drei kleine Präsente gemacht, in Geschenkpapier eingewickelt und mit Band verziert.
»Dann beschäftige dich. Lies irgendwas. Oder noch besser: Räum dein Zimmer auf …«
Er warf ihr einen Blick zu, rollte dabei die dunklen Augen und brachte sie endgültig zum Lachen. Den macht er in zwanzig Jahren noch genauso, dachte sie, die Stirn in Falten, aber in den Augen der Schalk.
Sie sah oft seinen Vater in ihm. David hatte Saids dunklen Teint; er war eher klein und schmal und konnte, wenn er wollte, über einen entwaffnenden Charme verfügen. Aber anders als bei Said kam bei David eine tiefe Melancholie dazu, wie sie sie noch bei keinem Kind seines Alters gesehen hatte.
Aus dem Bad hörten sie die Klospülung. Hanna kam in die Küche geschlurft. »Der Kaffeegeruch zieht bis in mein Schlafzimmer«, sagte sie, »da kann das beste Murmeltier nicht mehr schlafen.«
Auch Hanna trug noch ihr Nachthemd, ein hellblaues Gewand im Großmutterstil, dazu rote Flip-Flops. Ihr Gesicht wirkte verschlafen, das Haar stand in die verschiedenen Richtungen ab. Trotzdem sah Martha ihre Schönheit, das Ebenmäßige und Anziehende, das sie besaß.
Hanna nahm sich einen Becher aus dem Küchenschrank, bediente sich am Kaffee, pustete und trank abwechselnd. Sie stand direkt unter dem gerahmten Poster, das sie selbst aufgehängt hatte: »Der Kuss«. Martha hatte sich damals jeden Kommentar verboten. Said war erst wenige Wochen aus- und Hanna gerade eingezogen, und Martha hatte sich vorgenommen, in Zukunft weniger zu bestimmen, weniger zu kontrollieren. So hing das Bild dort, eine oft gesehene Pariser Straßenszene in einer Hamburger Wohnung.
Hanna strich David übers Haar, was seinen Scheitel in Unordnung bringen sollte. »Na, Lieblingsneffe? Zu welchem Fest gehst du denn heute?«
»Papa hat Geburtstag. Aber erst um elf.«
»Stimmt, heute ist Saids Geburtstag. Freust du dich?«
Er nickte.
Hanna wandte sich an Martha: »Und du? Gehst mit?«
»Ich bin eingeladen.« Martha schnitt sich eine Orange auf und wechselte das Thema. »Wie war’s gestern Abend?«
»Viele wichtige Leute …« Hanna strich sich nur einen Hauch Butter aufs Brot und kaum mehr Marmelade. Sie war Schauspielerin. Martha überredete sie hin und wieder, zu Festen zu gehen, wo sich Kontakte knüpfen ließen.
»Und«, fragte Martha, »was sagen die wichtigen Leute?«
»Viele Versprechungen, manche Anzüglichkeit.« Sie verzog das Gesicht. »Gefallen gegen Gefallen, hat einer gesagt.«
David verdrückte sich in sein Zimmer.
»Und du gehst jetzt zu Saids Geburtstag?«, fragte Hanna.
»Na und?«
Auch wenn’s ihr schwer gefallen war wie noch nie etwas im Leben, hatte sie nach der Trennung auf Abstand gesetzt. Drei, höchstens vier Mal war sie in Saids Wohnung gewesen, zu kurzen Besuchen, um David abzuholen oder um Said etwas zu bringen. Doch in ihren Träumen erschien er regelmäßig. Sie stritten, es gab Wut und Tränen und manche Versöhnung.
»David zum Gefallen«, setzte sie hinzu. »Zwei Stunden. Maximum.«
Hanna grinste. »Na dann: viel Spaß.«
Dieses Grinsen hätte sie sich von niemand anderem gefallen lassen, von Hanna nahm sie es hin. Hanna hatte ihren Zusammenbruch miterlebt. Sie wusste, welche Mühe es Martha gekostet hatte, von Said loszukommen. Wie ein Entzug.
Die ersten Male, die sich Said mit anderen Frauen eingelassen hatte, hatte Martha überhaupt nicht wahrgenommen. Vielleicht gab es keine Zeichen; vielleicht wollte sie keine sehen. Doch später konnte sie die fremden Gerüche und Telefonnummern nicht mehr ignorieren. Sie packte ihm seine Bettdecke aufs Sofa im Wohnzimmer. Davids Erstaunen tat ihr weh, seine Angst und seine plötzliche Hellhörigkeit machten ihr ein schlechtes Gewissen. Für sich selber fürchtete sie, ins Bodenlose zu fallen. Trotzdem sagte sie zu Said: »Ich möchte, dass du ausziehst. Und zwar schnell.«
Sofort danach schlief sie mit einem Volontär, Hendrik. Das war ein blonder Schlacks, der sie mit großen Augen ansah, wenn er glaubte, sie merke es nicht. Er war sechs Jahre jünger. In seinen Armen, mit geschlossenen Augen, dachte Martha ununterbrochen an Said.
Der eigentliche Kampf begann danach. Die Sehnsucht, die Eifersucht, die Einsamkeit. All die Gespräche, die sie in Gedanken mit ihm führte, über Alltagsdinge genauso wie über Grundsätzliches. Sie ertappte sich dabei, nach Feierabend das erste Glas Wein zu trinken und schon mittags darauf zu warten. Sie schlief schlecht, wurde mager und arbeitete ohne Konzentration. Die wenige Kraft, die ihr blieb, verwendete sie auf ihren melancholischen Sohn.
Für Hanna endete damals ein Engagement am Schauspielhaus in Bochum, sie kam zurück nach Hamburg und suchte eine Bleibe, und Martha war froh, dass sie bei ihr und David einziehen wollte. Ihre kleine Schwester half ihr über manchen einsamen Abend und manchen tristen Sonntag hinweg.
Hannas Einzug nahm Martha zum Anlaß, alle Erinnerungen an Said aus der Wohnung zu tilgen. Was er angeschafft hatte, verschwand, was er von seinen Sachen hatte stehen lassen, schickte sie ihm nach oder brachte es ihm. Sogar aus ihrem Fotoalbum riss sie Bilder heraus. Nur waren die Lücken nicht weniger schmerzvoll.
Zwei Stunden später, in Saids Treppenhaus, war David vorneweg gelaufen, hatte immer zwei Stufen auf einmal genommen und war nicht müde geworden, bis er im vierten Stock angekommen war. Martha akzeptierte, dass der Junge an seinem Vater hing und seine Vorfreude zeigte. Sie nahm sein Verhalten als Zeichen dafür, dass er alles ganz gut überstanden hatte.
Saids Treppenhaus war renoviert worden. Die Wände strahlten grau-weiß. Allerdings gab es auf der Treppe und an den Wohnungstüren weiße Farbkleckse. David wartete vor der Wohnungstür, und als er seine Mutter endlich kommen sah, nahm er ihr die drei Geschenke aus der Hand und klingelte stürmisch.
Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen, entriegelt, und eine Kette wurde gelöst. Said war angezogen und rasiert. Er ging in die Knie, umarmte seinen Sohn, drückte ihn und ließ sich gratulieren. Er bedankte sich für die Geschenke, die David ihm überreichte.
»Ihr schließt aber gründlich ab«, sagte Martha zur Begrüßung. Dann ließ sie sich von Said umarmen.
»Vorsicht ist die Mutter allen Seins.« Said legte Riegel und Kette wieder vor.
Ein kleiner Flur führte in einen hohen Raum mit einer Reihe einfacher Fenster, die in schwarze Stahlrahmen gefasst waren. Martha wusste von David, dass dieser Raum im Winter schwer zu heizen war, doch jetzt war es warm und zwei Fenster standen offen.
Für Saids Verhältnisse war es unglaublich ordentlich. Kein benutztes Glas im Bücherregal, keine leeren Bierflaschen auf dem Fußboden. Auf dem Fernseher gab es keinen Staub, auch nicht auf den Dielen. Sie wusste, an wem das lag, sie kannte sie aus Erzählungen. Jetzt beobachtete sie, wie vertraut sie ihren Sohn begrüßte, sie legte ihm die Hände auf die Schultern und strich ihm über die Oberarme.
»Hallo Sonja«, gab er zurück.
Der Tisch war gedeckt. Auf ihm lag ein weißes Tischtuch mit Bügelfalten. Kerzen brannten. Es gab Kuchen und Brötchen, Mozzarella mit Tomaten, einen großen Salat aus frischem Obst, Käse und Schinken und Kakao für David. Ein bisschen reichlich für nur fünf Leute, fand Martha.
»Wir haben schon gefrühstückt«, sagte David.
»Für ein Stück Kuchen wird wohl noch Platz sein«, sagte Said. »Den hat Sonja gebacken.«
Martha schüttelte Konrad die Hand, Saids Freund, seinem Mitbewohner. Said stellte die beiden Frauen einander vor, auch sie gaben sich die Hand. Außer Sonja setzten sich alle. Sie war rothaarig und hatte wässrige Augen, wirkte trainiert und hielt sich sehr gerade. Als wäre sie die Gastgeberin, überblickte sie den Tisch, prüfte, ob noch etwas fehlte, brachte einen Teelöffel. Sie war es, die den Kuchen anschnitt und den Kaffee einschenkte. Hatte Said sich also wieder jemanden auf die Kommandobrücke geholt.
Sonja versorgte David mit Kakao und lächelte ihn an. Martha widerstand dem Impuls, aufzustehen und sich neben ihren Sohn zu setzen.
Said zog inzwischen an seinem Zeigefinger und verhakte den Daumen mit einem anderen. Seine Hände waren schmal. Es lag viel Kraft und Konzentration darin, wenn er sie einsetzte. David aß von Sonjas Nusskuchen und lobte ihn, was Martha als gut erzogen verbuchte. Said begann, David Fragen zu stellen, nach der Schule, dann nach seinem Fußball. Die Fragen klangen mechanisch, der Junge antwortete spärlich. Said wirkte abwesend. Er schlug mit den Knöcheln einen Rhythmus auf den Tisch.
Konrad saß ihr gegenüber, Saids ältester, vielleicht sein einziger Freund. Nach der Trennung war es keine Frage gewesen, dass die beiden Männer in eine Wohnung zogen. Konrad war Historiker, hatte Lehraufträge an der Uni und schrieb gelegentlich in Fachzeitschriften. Ein magerer Kerl, das Hemd schlotterte ihm um Brust und Arme, und er wurde am Hinterkopf kahl. Er trug eine winzige runde Brille, die ihn klug aussehen lassen sollte.
»Erzähl du mal ein bisschen«, sagte David zu seinem Vater.
Said verzog das Gesicht und begann, mit seinen schlanken Fingern ein Glas auf dem Tisch zu bewegen, er kippte es vorsichtig von einer Seite zur anderen, sodass der Saft bis zum Rand anstieg, aber nicht auslief.
»Ich … wollte … ein neues Heft machen. Aber … ach nee, ich weiß nicht …« Er ließ das Glas los und lehnte sich an die Stuhllehne. »Ich zeige es dir, wenn es fertig ist. Falls es fertig wird.«
Er senkte den Blick. Über neue Projekte hatte er noch nie gern gesprochen. Martha wusste, nicht zuletzt aus Davids Erzählungen, dass Said als Comiczeichner immer noch kaum Geld verdiente und als Sanitäter auf einem Rettungswagen arbeitete. Wie zu ihrer Zeit.
Nur diese Nervosität kannte sie nicht an ihm. Ob das mit ihr zu tun hatte? Damit, dass sie und Sonja zusammentrafen?
»Sonja ist übrigens Krankengymnastin«, sagte Said.
»Physiotherapeutin.« Sonja lächelte.
Martha war bereit, den Faden aufzunehmen. »Und wo arbeitest du?«
»Ich habe eine eigene Praxis. Zusammen mit zwei Kolleginnen.«
Said war wieder ausgestiegen. Er stand auf und ging zum Kühlschrank. »Jetzt trinken wir«, rief er.
»Noch zu früh«, entgegnete Konrad.
»Quatsch früh. Ich bin sechsunddreißig. Seit heute gehe ich auf die vierzig zu.«
Martha und Konrad ließen sich breitschlagen. Sonja lehnte ab und blieb dabei, obwohl Said mehrere Überredungsversuche unternahm. Er entkorkte die Flasche und lachte, als es einen lauten Knall gab. Sekt sprudelte heraus, lief auf den Boden und dann auf einen Teller, den Sonja unter die Flasche hielt.
»Ich glaube, dazu brauche ich einen weiteren Kaffee«, sagte Martha. »Kann ich noch einen aufsetzen?«
»Klar«, sagte Said, »was du willst.«
Aber Sonja griff nach der Kanne. »Ich mach schon.«
Es dauerte nicht lange, da begann David genauso unruhig zu werden wie Said. Als wenn er das aufnähme. Der Junge spielte mit seinem Teelöffel, stellte ihn auf und ließ ihn umfallen. Er trommelte mit Messer und Gabel auf die Tischdecke. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her, und schließlich stand er auf und lief umher. Vor dem Fernseher blieb er stehen, schien sich aber zu sagen, dass er eh keine Erlaubnis bekommen würde.
Martha nahm das Zeichen auf, und David nickte, als sie ihm anbot, nach Hause zu gehen. Da waren noch keine anderthalb Stunden vergangen. In Gedanken schickte Martha einen Gruß an ihre Schwester: ein problemloser Vormittag, meine Liebe. Berührt mich nicht – und das nicht etwa, weil ich zwei oder drei Gläser Sekt getrunken habe. Ich glaube, ich bin drüber hinweg.
Sie verabschiedeten sich von Sonja und Konrad, und Martha ertrug auch, dass Sonja Davids Hand lange in ihrer hielt und »Bis bald« sagte. Er nickte.
Said brachte sie zur Tür. Martha sparte sich einen weiteren Kommentar über Riegel und Kette. Als sie sich umarmten, fühlte sie seine frisch rasierte Wange an ihrer.
2
Wagners erster Blick blieb an den Stühlen hängen. Er kam selten her – sehr selten –, aber wenn, dann stachen ihm diese Stühle ins Auge.
Er kannte ihre Bedeutung, sah ihre Schönheit. Entworfen von dem Amerikaner Charles Eames. Schlicht, funktional, dabei vollendet. Meilensteine, Museumsstücke – und für einen Mann wie Kelber viel zu schade.
Wenn Kelber mit ihm reden wollte, bedurfte es eines von ihren Sekretärinnen vereinbarten Termins. Als Leiter der Exportkontrolle, der wichtigsten Abteilung beim Bundesamt für Wirtschaft, ließ sich Wagner nicht dienstlich auf dem Flur anquatschen. Auch nicht vom Präsidenten der Behörde. Erst recht nicht von dem.
Er musterte Kelber. Der Mann mochte Ende vierzig sein, gab sich aber Mühe, jünger auszusehen. Er trug eine Designerbrille, außerdem eine gelb und blau gestreifte Krawatte und einen Anzug, der seine Figur betonte. Kelber war schlank und trainiert. Fitnessstudio. Gerüchte in der Behörde besagten, Kelber interessiere sich nur für Männer. Wagner ignorierte diesen Menschen, soweit es ging.
Sechs Eames-Stühle standen um den Besprechungstisch, alle mit blaugrauen Stoff bezogen und akkurat unter die Tischkante geschoben. Am Schreibtisch gab es einen weiteren, aus Leder, mit Rollen und hoher Lehne. Das ganz teure Modell. Kelber saß auf ihm und hob den Blick.
»Ah, Herr Wagner. Schön, dass Sie so pünktlich sind.«
Kelber kam seinem Gast ein paar Schritte entgegen, reichte ihm die Hand und begrüßte ihn mit einer Freude, die Wagner für gespielt hielt. Sein Gastgeber wies in Richtung Tisch. Wagner zog einen der blaugrauen Stühle hervor, strich mit zwei Fingern über ihn und setzte sich. Er ließ seinen Rücken den Stoff fühlen.
»Ich bekam einen Anruf aus Berlin«, begann Kelber. Er hatte sich Wagner gegenübergesetzt und sein Bein übergeschlagen. Seine Arme lagen auf den Stuhllehnen. »Direkt vom Wirtschaftsminister. Das heißt, von seinem Staatssekretär.«
Wagner tat dem Behördenpräsidenten nicht den Gefallen, nachzufragen, er wartete einfach. Er war in keiner Weise bereit, Interesse zu heucheln oder eifrig zu tun, und er hatte es auch nicht nötig. Sein Standing in der Behörde war bestens. Die Kollegen in seiner Abteilung schätzten ihn. Wagner ließ ihnen freie Hand, und wenn der Schlendrian um sich griff, redete er mit den Leuten, aber er tobte nicht und wies sie auch nicht zurecht. Ein anderer Führungsstil als der von Kelber.
»Wie es scheint«, fuhr Kelber fort, »verfügen die Amerikaner über Geheimdienstinformationen, nach denen das iranische Atomprogramm mit deutschen Ausrüstungsgütern bestückt wird.«
»Ach? Und was sind das für Informationen? Kann man die nachprüfen?«
Kelber schüttelte den Kopf. »Es gibt nur diese allgemeinen Hinweise. Für mehr scheinen uns die Amerikaner nicht zu vertrauen. Sie sind davon überzeugt, dass der Iran im Besitz deutscher Waren ist. Verbotener Waren. Und dass noch mehr dorthin gelangt.«
»Welche Wege auch immer diese Güter nehmen.«
Kelber winkte ab und drehte den Kopf weg. »Selbstverständlich. Das wissen wir beide. Dem Staatssekretär kann ich gerade noch klar machen, dass wir kaum die Verantwortung dafür zu übernehmen haben, wenn irgendein internationaler Kunde seine in Deutschland gekauften Waren weiterreicht. Der Staatssekretär kennt unsere Arbeit. Aber den Amis kann man das nicht mehr erklären. Für die ist das deutsche Wertarbeit und kommt deshalb aus Deutschland.«
»Und was folgt nun daraus?«, fragte Wagner. Seine Aufmerksamkeit war mehr bei dem Eames-Stuhl als bei Kelber. Man saß nur auf dem Stoff, der zwischen das Gestell gespannt war. Es gab keinen Unterbau. Deshalb konnte sich der Stuhl so leicht dem Körper anpassen, dem er gleichzeitig ausreichend Widerstand bot.
»Der Staatssekretär bittet uns, in diesem heiklen Fall aktiv zu werden. Er setzt auf unser Gespür. Auf unser Fingerspitzengefühl, wenn Sie so wollen. Deshalb ist das eine große Aufgabe. Wir sollen alle Firmen überprüfen, die in den letzten zwanzig, dreißig Jahren einschlägig aufgefallen sind. Wo wir auch nur den leisesten Zweifel hegen, da sollen wir hinfahren. Die Firmen besuchen. Mit den Leuten reden und uns ein Bild machen. Verstehen Sie?«
Neitzel, dachte Wagner. Er schüttelte den Kopf und sagte: »Ich fürchte, dafür habe ich kein Personal.«
Kelber nahm seine bunte Brille ab und drehte sie in der Hand. »Kein Personal?« Er setzte ein falsches Lächeln auf. »Sie fahren selber. Sie persönlich.«
Wagner fixierte sein Gegenüber. »Wer sagt das?«
»Ich sage das. In Absprache mit dem Staatssekretär. Ein Wunsch des Ministers.«
Wagner war nicht bereit, sich irgendwohin schicken zu lassen. Wenn Kelber Fleißpunkte in Berlin sammeln wollte, dann musste er seinen Hintern schon selber bewegen.
»Und wann sollte ich das machen?«
Kelber veränderte seine Sitzposition. Er stellte auch das zweite Bein auf den Boden und rückte mit dem Oberkörper ein paar Zentimeter nach vorne, in Richtung seines Gesprächspartners. Wagner roch sein aufdringliches Rasierwasser. Er wollte ausweichen und sich weiter zurücklehnen, doch er war schon an der Stuhllehne angelangt.
»Sehen Sie, verehrter Kollege Wagner, Sie scheinen noch nicht ganz zu verstehen. Es handelt sich um eine Bitte der Bundesregierung.« Kelber hob die linke Hand. »Höchste Ebene.« Er kniff die Augen zusammen und nickte. »Es drohen Verstimmungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Neuerliche Verstimmungen. Das kann unser Land nun wirklich nicht gebrauchen. Unsere Arbeit war ein Tagesordnungspunkt im Bundeskabinett. Ein eigener TOP. Erkennen Sie langsam die Größenordnung?«
Wagner griff mit beiden Händen nach den Armlehnen und spürte das kalte Metall. Sein Blick wanderte durch das Zimmer. Er verscheuchte einen neuerlichen Gedanken an Neitzel.
»In der Abteilung gibt es unter den Kollegen regionale Zuständigkeiten. Wenn diese Angelegenheit eine solche Bedeutung hat, dann wäre es sicher vernünftig, wenn der jeweils Zuständige …«
Kelber schüttelte den Kopf. »Sie fahren. Persönlich. Das hat Berlin entschieden. Und zwar, wenn möglich, noch diese Woche.«
Eine solche Reise gehörte schlicht nicht zu seinen Zuständigkeiten. Und Kelber hatte den falschen Tonfall gewählt.
Sein Gegenüber setzte die Brille wieder auf und legte die Stirn in Falten. Jungenhafte Falten, fand Wagner. Gespielter Ernst.
»Zunächst brauchen wir eine Liste«, sagte der Präsident. »Schreiben Sie alle Firmen darauf, die in dem genannten Zeitraum auffällig geworden sind. Zwanzig, dreißig Jahre. Dann: In welchen Bereichen sind diese Firmen heute tätig? An wen liefern sie und was? Wer sitzt im Management? Und wo Zweifel bleiben – selbst kleinste Zweifel –, da muss ich Sie bitten, hinzufahren. Sie müssen diesen Leuten ins Gewissen reden. Drohen Sie ihnen von mir aus. Da haben Sie Gestaltungsspielraum. Nur: Machen Sie ihnen klar, dass wir sie im Visier haben.«
Neitzel, dachte Wagner wieder.
Es war nicht vernünftig, seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob Kelber bittebitte sagte oder nicht. Er ließ sich nirgendwohin schicken, von Kelber nicht und auch nicht vom Staatssekretär. Aber er konnte kaum anders, als das Vorhaben richtig zu finden. Waren die Hinweise der Amerikaner auch noch so vage – ausgerechnet der Geheimdienst, lächerlich –, reagierte man doch lieber zweimal zu oft als einmal zu wenig.
Er überdachte, was auf seinem Schreibtisch auf ihn wartete, dann nickte er innerlich. Kelber zeigte er seine Zustimmung noch nicht.
Doch der schien Wagners Gedanken zu ahnen. »Mir ist doch klar, dass Sie beschäftigt sind. Das sind wir alle. Aber wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Das zeichnet eine gute Verwaltung aus: dass sie Prioritäten setzen kann. Noch etwas: Ich möchte diese Sache so still ausgeführt haben wie möglich. Auch das ist ein ausdrücklicher Wunsch des Staatssekretärs. Diskretion, verstehen Sie. Weihen Sie nur diejenigen Kollegen ein, die unbedingt notwendig sind. Verpflichten Sie auch sie zu absolutem Stillschweigen. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, lassen Sie es mich wissen. Sollte diese Sache irgendwann einmal publik werden, dann bitte nicht aus meiner Behörde. Ich möchte mir nichts anhängen lassen. Arbeiten Sie als Erstes an der Liste. Und dann sprechen wir drüber. Wenn möglich, morgen. Spätestens übermorgen.«
»Ich sehe, was ich tun kann«, sagte Wagner.
Kelber nickte, beide standen auf. Wagner warf einen letzten Blick auf die Stühle. Definitiv zu schade für Kelber.
Als er an der Tür war, rief sein Vorgesetzter ihn noch einmal. »Wir brauchen die Liste wirklich schnell. Machen Sie sich bitte gleich daran.«
Mit einem Nicken ging Wagner hinaus.
Weitere Leseproben:
Freyas Land - Rachemelodie - Die Herren der Schwerter - Das Kreuz der Hugenotten - Made in HH - Siegeszeichen